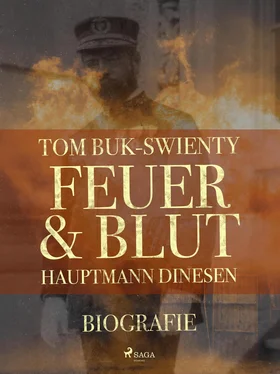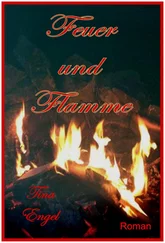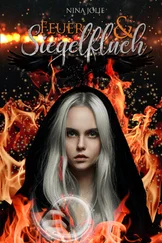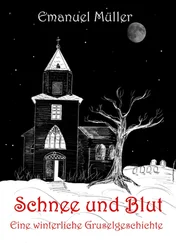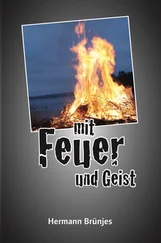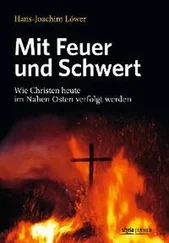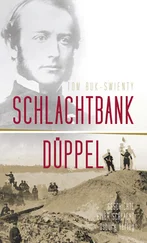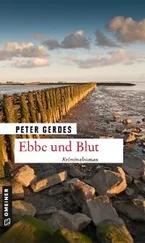So bekam Dänemark mit dem Grundgesetz von 1849 eine der freiesten Verfassungen der Welt. Alle Bürger, auch die Bauern, bekamen das Wahlrecht, jedoch keine »Frauenzimmer, Verbrecher und Narren«, wie es hieß. Man kann nicht genug hervorheben, welch epochale Bedeutung dieses Ereignis für die dänische – um nicht zu sagen, europäische – Geschichte hatte. Nach fast zweihundert Jahren des Absolutismus bekamen die Dänen mitten in diesem tumultartigen Krieg – und in hohem Maß durch den Krieg – eine konstitutionelle Monarchie. Die politische Obrigkeit des Landes war nicht länger der König, sondern der Reichstag. Ein völlig neues Dänemark war entstanden und hatte mit dem Ausfall bei Fredericia den alten Schandfleck der Englandkriege abgewaschen. Abgewaschen zwar mit Blut, aber durch den Verlust der Flotte 1807, die Abtretung Norwegens 1814 und die Degradierung zu einem machtpolitisch drittrangigen Staat war Dänemark so eingeschüchtert und traumatisiert gewesen, dass der Sieg bei Fredericia einen nationalen Begeisterungstaumel auslöste. Er übertraf sogar die bewegten Tage im Frühjahr 1848 vor Ausbruch des Krieges.
Alle, die in der Nähe der Lazarette bei Fredericia gewesen waren, die Eimer um Eimer und Bottich um Bottich mit amputierten Füßen, Beinen, Händen und Armen gesehen hatten, von Granatkugeln aufgerissene Bäuche, zerschmetterte Köpfe und klebrige Hirnmasse, alle, die diese vielen jungen Menschen röcheln gehört hatten, das unerträgliche Röcheln der Sterbenden – sie alle wussten natürlich, was Krieg in Wirklichkeit bedeutete. Und was der Preis für den Sieg gewesen war. Aber das Grauen, das der tapfere Landsoldat in seinem Herzen gefühlt hatte, wurde von dem kollektiven Freudengebrüll übertönt, das sich im ganzen Land erhob, als der Sieg bei Fredericia verkündet werden konnte und das aufständische Heer sich zum Rückzug nach Süden gezwungen sah.
Im darauffolgenden Jahre bekämpfte ein dänisches Heer, das inzwischen mehr als 40 000 Mann zählte, die Aufständischen. Deren zugegeben heftiger Widerstand wurde nur als letzte krampfartige Zuckung einer verlorenen Sache angesehen. Dennoch musste das dänische Heer seine gesamten Truppen einsetzen, um die Gegner in die Knie zu zwingen. Am 24. und 25. Juli 1850 stießen die beiden Heere auf der Heide von Isted in einer fürchterlich chaotischen und blutigen Schlacht aufeinander – einer der bis dahin größten Schlachten in der Geschichte Nordeuropas. Die Aufständischen wurden in die Defensive gezwungen.
Am Neujahrstag 1851 erdröhnte der letzte Schuss in diesem Krieg. Er kam von der Batterie Dinesen.
A.W. Dinesens Kanonen hatten im Jahr zuvor unaufhörlich gesprochen. Die Batterie Dinesen war bei fast allen großen Schlachten und Kämpfen dieses Krieges dabei: Bov, Schleswig, Düppel, Isted und Mysunde. Und A.W. Dinesen, der nach dem Krieg zum Major befördert wurde, berichtete fröhlich von seinen Triumphen. Am 11. April 1849 schrieb er von der Front an seine Schwester Augusta über die letzten Kämpfe bei Düppel, die mit einem dänischen Sieg endeten. Hier nahm die Batterie Dinesen an einem, wie er es nannte, »netten Vorpostengefecht« teil.
»Meine Batterie war die einzige Artillerie, die mit dabei war«, schrieb er seiner Schwester, »und ich beschoss den Feind mit 130 Granaten und 74 Kugeln, so dass ich an dem Tag recht zufrieden mit dem Dirigieren der Kanonen war, die den Ausschlag gaben, da die deutschen Truppen dem Kanonenfeuer überhaupt nicht standhalten konnten.«
A.W. Dinesen war in seinem Element, auch wenn zum Krieg nun auch eine gute Portion Langeweile gehörte. »Schreib mir doch ab und zu ein paar Worte mehr. Ich freue mich stets, Briefe von meinen Liebsten zu erhalten, ganz besonders in diesem einsamen und langweiligen Leben im Quartier.« In anderen Phasen des Krieges lagen die Nerven völlig blank – selbst bei A.W. Dinesen. 1849 verfügten die Deutschen über ein fast doppelt so starkes Heer wie die Dänen. »Man zählt die Deutschen, und es scheinen zu viele zu sein ... Was die Zukunft bringen wird, scheint in diesem Augenblick im Dunkeln zu liegen«, schrieb er in demselben Brief, in dem er gegenüber seiner Schwester mit seinem Sieg über den Feind geprahlt hatte.
Zwischendurch war der Krieg dagegen auch einfach nur jämmerlich, abscheulich und schmutzig. Freunde wurden verstümmelt oder von den Kugeln des Feindes aus dem Leben gerissen. In solchen Stunden erlebte auch A.W. Dinesen die destruktive Kraft des Krieges als absurd, hässlich und traumatisch.
Aber so sprach man nicht vom Krieg, und schon gar nicht, wenn man als Sieger daraus hervorging. Das Grauen, die Furcht und der Wahnsinn waren leichter aus dem Kopf zu bekommen, wenn man zu einem Meer aus Dannebrog-Fähnchen heimkehrte und immer wieder hörte, dass man einen gerechten vaterländischen Kampf geführt hatte.
Die Begeisterung und das Gefühl des nationalen Schwungs trugen dazu bei, dass der aristokratische Stand die politischen Niederlagen akzeptieren konnte, die er durch die Einführung der neuen Verfassung erlitten hatte. Zumal die Konjunktur in der Landwirtschaft weiterhin gut war. Was die Gutsbesitzer an politischem Einfluss einbüßten, gewannen sie an wirtschaftlichem Reichtum, der noch immer in politische Macht umgemünzt werden konnte. Aber dazu später mehr.
Abgesehen von den trüben Stimmungen und den düsteren Momenten, die es im Leben eines jeden Soldaten gibt, leistete Hauptmann A.W. Dinesen mit großer Begeisterung seinen Dienst. Er war furchtlos bis ins Mark und erregte mit seiner selbstsicheren Erscheinung bei allen Bewunderung, die mit oder unter ihm kämpften. Und diese Geschichten von den berühmten Kriegstaten waren es auch, die seinem Sohn Wilhelm in seiner Kindheit immer wieder erzählt wurden.
Aber während der Patriarch draußen im Feld als mutigster Mann des Reiches Ruhm errang, führte die Familie zu Hause auf Katholm Gods ein glanzloses Leben.
A.W. Dinesens Familie lebte in ständiger Angst, ihn während des Dreijährigen Krieges zu verlieren.
Während der Kämpfe des Schleswig-Holsteinischen Krieges wusste die Bevölkerung oft genug nicht, welches der Heere gerade die Oberhand hatte. War eine große Schlacht geschlagen, konnten Tage vergehen, bevor die Zivilbevölkerung davon erfuhr und informiert wurde, wer gesiegt hatte. Die Nachrichten mussten per Kurier, Postkutsche oder Schiff übermittelt werden. Die Menschen wussten deshalb auch nie, ob der Feind nicht plötzlich vor ihrer Tür stand oder ob ihre Angehörigen in Uniform überhaupt noch am Leben waren. In der Stadt und auf dem Land, bei Reich und Arm, herrschten Sehnsucht und tiefe Sorge, bis ein Kurier oder Schiffer erschien.
An einem Gewittertag im Frühjahr 1848 lief ein Schiff mit einem solchen Boten an Bord in den Hafen von Grenaa ein. Er brachte die letzten Meldungen vom Schlachtfeld in Form eines Briefes von A. W. Dinesen. Der Brief wurde dem Arzt der Familie Dinesen, Doktor Arendrup, überbracht, der ihn sofort nach Katholm weiterleiten sollte. In einer seiner wenigen schriftlichen Kindheitserinnerungen berichtet Wilhelm Dinesen von diesem Ereignis. »Doktor Arendrup ließ seine Kutsche anspannen«, schreibt er. Um in südliche Richtung nach Katholm zu kommen, musste der Pferdewagen über den Fluss Grenaa Å, der infolge der vielen Wolkenbrüche während des Unwetters stark angestiegen war. Das Wasser stand so hoch, dass es gefährlich über die Brücke schwappte, die über den Fluss führte. »Der Kutscher reagierte barsch und schwor, auch wenn es sein Leben gelte, würde er an diesem Tag nicht über die Brücke fahren. Aber der Doktor sagte, dass aus Schleswig ein Brief vom Hauptmann gekommen sei, der überbracht werden müsse – und da spannte der Kutscher die Pferde an und flüsterte ihnen etwas ins Ohr, und es ging ohne Probleme über den Fluss und in scharfem Trab auf Katholm zu.«
Читать дальше