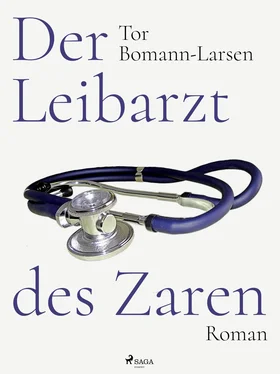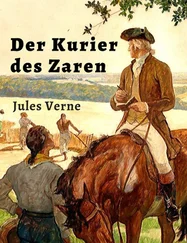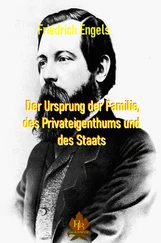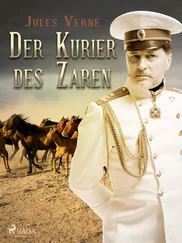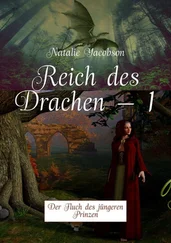Mir persönlich hat der Gedanke an die Großfürstin Olga als Russlands künftige Zarin immer zugesagt.
Ein ganzes Jahr arbeiteten wir daran, das Bein geradezurichten, das sich im Verlauf der Krankheit bis zum Brustkorb hochgezogen hatte. Am Bein wurde eine Metallschiene befestigt, die wir Zentimeter für Zentimeter streckten, wonach das Bein nach und nach seine Beweglichkeit zurückerhielt. Später machte er auf der Krim eine Kur mit Schlammbädern. Alexej Nikolajewitsch brauchte ein ganzes Jahr, um auf seinem linken Bein wieder annähernd normal stehen zu können.
Zum 300-jährigen Jubiläum der Romanow-Dynastie wurden vom Thronfolger mehrere Fotos aufgenommen, auf denen das krumme Bein getarnt war wie der verkrüppelte linke Arm Kaiser Wilhelms II. Dennoch musste er von einem hünenhaften Kosaken getragen werden, als die kaiserliche Familie am 6. März 1913 während der Prozession im Kreml beim Festgottesdienst in der Kasan-Kathedrale eintraf. Der Anblick des invaliden Thronfolgers löste in der Bevölkerung eine Welle der Unruhe aus.
Nur die Zarin war in der Folgezeit in ihrem Glauben unerschütterlich. Sie war vor dem letzten Bulletin am imaginären Grab ihres Sohnes an der äußersten Grenze ihrer Kraft angelangt. Unter dem frostklaren Himmel von Spala hatte sie ein Telegramm erhalten, das ihr Schicksal für immer mit Sibirien verbinden würde.
Es knarrt, wenn Sednjew sich auf dem Feldbett umdreht. Dafür schläft der Kammerdiener geräuschlos; nur selten einmal ertönt ein trockenes Räuspern. Ab und an ein plötzlicher Laut vom Zimmer des Kommandanten hinter der Wand.
Das Leben ist der Leib zwischen zwei Mysterien.
Sonne, leichter Schneefall.
Klarer als die bescheidene Größe des Hauses, als die beschränkte Größe des Gefängnishofs, ja sogar klarer als die deutliche Sprache der Palisade drückt der Anblick von Kommandant Awdejew den Charakter des neuen Regimes aus. Er ist zwar militärisch gekleidet, besitzt aber offenkundig keinen Rang. Man hat ihn von der Slokasow-Fabrik in der Nähe und dem örtlichen Parteiapparat rekrutiert. Er ist hochgewachsen und mager, trägt einen schmalen Bart in seinem unrasierten Gesicht, einen Revolver im Gürtel und Lederstiefel, die noch nie geputzt worden sind. Alexander Awdejew stinkt nach Wodka und umgibt sich mit einem Hofstaat aus gleichgesinnten, halb militärischen Kameraden. Durch die Organisation der Gefangenschaft hat er für alle offenkundig den Höhepunkt seiner administrativen Fähigkeiten erreicht. Seine Erscheinung ist eine Provokation gegenüber den kaiserlichen Gefangenen, und darin liegt vermutlich seine vornehmste Qualifikation.
Ich kämpfte meinen Widerwillen nieder und klopfte am Vormittag an der Tür des Kommandanten an. Niemand reagierte, doch drinnen waren Stimmen zu hören, und plötzlich wurde die Tür aufgerissen. Drinnen saßen zwei oder drei »Adjutanten« hingelümmelt und rauchten, während der Kommandant selbst auf einem Stuhl hinter dem Schreibtisch wippte. Die Luft war stickig wie in einer Fabrikhalle ohne Ventilation.
Ich erklärte mein Bedauern wegen der Störung und sagte, ich sei aus Anlass des besonderen Charakters des heutigen Tages gekommen. Awdejew hob eine Augenbraue und schob die Zigarette in den anderen Mundwinkel:
»Der 3. Mai? Haben wir Mittwoch oder Donnerstag?«
»Ich denke an das Osterfest, es ist Karfreitag.«
»Kommen Sie im nächsten Jahr wieder, Doktor.«
Ich hatte mich entschlossen, im Namen der Zarenfamilie diese Anfrage vorzubringen, und ließ mir bei dem Ton des Kommandanten nichts anmerken:
»An einem solchen Tag wäre es von der allergrößten Bedeutung, einen Anlass zu haben, der Messe beizuwohnen.«
»Der Messe?« Awdejews Gesicht war schierer Unglaube.
»Ja, beispielsweise hier auf der anderen Seite des Platzes in der Himmelfahrts-Kathedrale.«
»Sollen wir die Gefangenen freilassen, nur weil Sie behaupten, es sei Freitag? Als Nächstes kommen wohl Purpurmantel und Dornenkrone?«
Die »Adjutanten« grinsten.
»Es ist unzumutbar, die Messe zu entbehren, gerade in der Osterwoche.«
»Aber lassen wir doch ›den Blutigen‹ Karfreitag feiern, soviel er will, solange er dort innerhalb der Mauern bleibt, und keinen Schmutz, wenn ich bitten darf!«
Zum Glück hatte ich nur zwei Schritte in den Raum getan. Somit war der Rückweg kurz. Ich sah keinen Grund für weitere Formalitäten.
Der Zar verlas den Text des Tages. Wie viel hat sich in diesem einen Jahr seit dem vorigen Osterfest ereignet! Damals konnten wir die Schlosskirche noch mit Blumen aus den kaiserlichen Treibhäusern schmücken, und zusammen mit Dr. Derewenko ging ich hinter dem prachtvollen Umhang des Popen und trug das symbolische Leichengewand in einer Prozession durch Säle und Korridore des Palasts. Hinter uns folgten die Lichtträger. Hier, zwischen den Mauern des Ipatjew-Hauses, gibt es weder Klagelieder noch Jubeltöne. Selbst die Beichte hat man uns genommen.
Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie der Zar den Hals reckt und unseren neuen Kommandanten küsst, so wie er es gemäß der österlichen Tradition beim Kommandanten Koblinsky und dem wachhabenden Offizier im Alexanderpalais nach der letztjährigen Mitternachtsmesse getan hatte. Die Offiziere Kerenskijs konnten dem Zaren während der Gnadenfrist, die seiner Herrschaft noch blieb, in einer rituellen Geste entgegentreten. Für Awdejew, den Auserwählten der Bolschewiken, wäre das so etwas wie »der Todeskuss« gewesen.
»Elo’i! Elo’i! lama sabaktani?«
Der Zar hat keinen Willen. Nur ein Schicksal. Der Wille ist in der Erfüllung des Schicksals eingekapselt. Sie ist diejenige, die den Ehrgeiz auf Herrschaft verwaltet. Für ihn ist die Selbstherrschaft ein gegebener Zustand wie das Gras auf der Erde oder die Wolken am Himmel. Für sie ist sie eine Idee, eine göttliche Institution, würdig, verteidigt zu werden.
Der Zar regiert kraft seines Leibes.
Nur Gott soll dem Zaren die Macht nehmen können, indem er ihm das Leben nimmt. Doch Nikolaj Alexandrowitsch gab sein Amt in dem Moment auf, in dem er seine menschliche Stütze verlor. Das war die historische Trennungslinie am Bahnsteig in Pskow.
Und sie war nicht da.
Ich erinnere mich nicht an Seine Majestät während dieses Aufenthalts. Wahrscheinlich werde ich das nie tun können. Wie viele Runden uns noch auf dem Gefängnishof des Ipatjew-Hauses bevorstehen mögen, auf Pskow werden wir wohl mühelos verzichten können. Gleichwohl wurden die 24 Stunden auf dem Provinzbahnhof für alle unsere späteren Umzüge bestimmend, für alles, was danach geschehen ist, mit uns und mit Russland. Seitdem sind meine Gedanken jede Nacht mindestens einmal zu der äußersten Granitkante auf dem Bahnsteig in Pskow zurückgewandert.
Ich war nicht dort, kenne die Stadt in der Nähe der baltischen Provinzen jedoch gut. Während des Krieges wurde sie in ein einziges großes Lazarett verwandelt. Schulen, Internate, alle bewohnbaren Gebäude wurden in Beschlag genommen, um Plätze für Krankenbetten zu schaffen, je nachdem, wie die Kampfhandlungen hin und her wogten. Auch die Zarin ist in Pskow gewesen. Sie reiste dorthin, um die Hospitäler der Stadt zu inspizieren. Sie war als einfache Krankenschwester in Rot-Kreuz-Tracht verkleidet; aufgrund ihres schwachen Herzens musste die Pflegerin in einer Sänfte durch die verschiedenen Etagen des Krankenhauses getragen werden. Die Krankensäle durchschritt sie aus eigener Kraft. Die Zarin von Russland konnte sich davon überzeugen, dass in den Militärlazaretten von Pskow das Blut rot war, die leinene Wäsche weiß und alles in schönster Ordnung.
In der Stadt, die nur 150 bis 200 Werst von der Front entfernt war, hatte überdies das Nordkommando des Heeres seinen Sitz. Von hier gingen die Befehle der Generäle in Form verschlüsselter Telegramme ab, während die Verlustzahlen, für alle ablesbar, an den Zugladungen verstümmelter Körper sichtbar waren.
Читать дальше