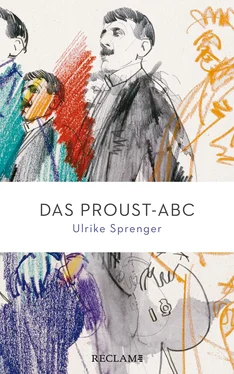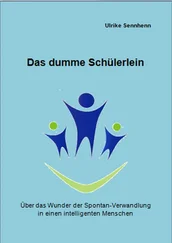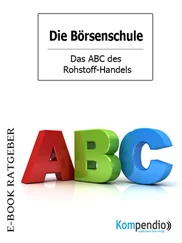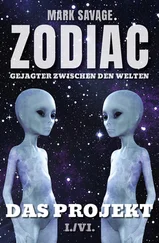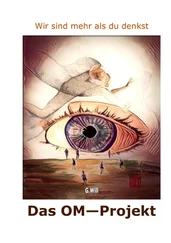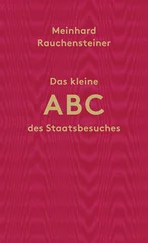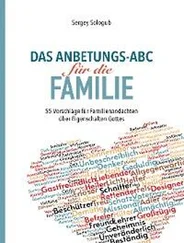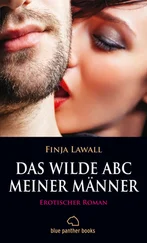Man darf den versöhnlichen Worten des Erzählers hier nicht uneingeschränkt glauben, denn die folgenden kunst- und kultursinnigen Ausführungen des Barons setzen das sadistische Spiel lediglich unter dem Deckmantel der »Verfeinerung« fort. Mit Belehrungen zu Rosensorten und Kritik an Morels musikalischen Auftritten demütigt der künstlerische Dilettant Charlus den im aristokratischen Milieu unsicheren Morel durch die fortwährende Zurschaustellung höfischer Kultur; die Szene gipfelt in einem bizarren Birnendialog zwischen Charlus, Morel und dem Kellner: »[…] denn Monsieur de Charlus sagte gebieterisch zu ihm: ›Fragen Sie den Oberkellner, ob er Gute Christen dahat.‹ – ›Gute Christen? Ich verstehe nicht recht.‹ – ›Sie sehen doch wohl, dass wir beim Obst angekommen sind. Es ist eine Birne. Seien Sie versichert, dass Madame de Cambremer welche hat, denn die Gräfin von Escarbagnas, und eine solche ist sie nun einmal, hatte welche. Monsieur Thibaudier schickt sie ihr, und sie sagt: ‚Hier haben wir einen Guten Christen, der obendrein sehr schön ist.‘‹ – ›Nein, das wusste ich nicht.‹ – ›Ich stelle darüber hinaus fest, dass Sie gar nichts wissen. Wenn Sie nicht einmal Molière gelesen haben … Nun gut, da Sie vom Bestellen kaum mehr verstehen dürften als von allem anderen, verlangen Sie ganz einfach eine Birne, die gerade hier in der Gegend geerntet wird, die Gute Luise von Avranches.‹ – ›Die …?‹ – ›Warten Sie, da Sie so ungeschickt sind, werde ich selbst nach anderen fragen, die ich lieber mag: Oberkellner, haben Sie die Doyenné des Comices? Charlie, Sie sollten die hinreißende Passage lesen, die die Herzogin Émilie de Clermont-Tonnerre über diese Birne geschrieben hat.‹ – ›Nein, mein Herr, die haben wir nicht.‹ – ›Haben Sie die Triomphe de Jodoigne?‹ – ›Nein, mein Herr.‹ – ›Oder Virginie-Dallet? Passe-Colmar? Nein? Na gut, da Sie nichts haben, gehen wir eben. Die Herzogin von Angoulême ist noch nicht reif; also los, Charlie, wir gehen.‹«
Die Aufzählung historischer Birnensorten entspringt nicht nur der Wortgewalt und Sprachlust des Barons – er stellt in dieser Szene sein ganzes aristokratisches Erbe aus, die edlen ►Namen der Birnen ersetzen ihm die Aufzählung von Adelsgeschlechtern, deren ►Genealogien ihm ebenso vertraut sind wie die natürlichen Reifezeiten der Früchte. Zusätzlich leitet er dieses Wissen her aus seiner intimen Kenntnis klassisch höfischer Literatur – mit seinem Zitat einer Birnenszene bei Molière schüchtert er Morel und den Kellner weiter ein, bevor er nach vollem Auskosten seiner sozialen wie kulturellen Überlegenheit den Abgang befiehlt. Prousts eigene, unverkennbar lustvolle Inszenierung dämpft allerdings den Triumph des Barons. Scheinen dessen Auftritte häufig dem klassischen Theater entlehnt – erinnern zum Beispiel seine rasenden Wutanfälle an Szenen vernichtender Leidenschaft aus Racines Phädra –, so gestaltet Proust den Birnenauftritt des Barons wie eine Szene aus einer Komödie Molières: Im hemmungslosen Ausleben seines aristokratischen Dünkels, in seiner Selbstberauschung an der Pracht adeliger Namen wird Charlus zu einer so tyrannischen wie komischen, seiner Adelsobsession und seinem Kulturfetischismus blind verfallenen Figur, die sich in ihrer verbalen Entgleisung vor einem ›vernünftigen‹ Publikum (Morel, der Kellner, der Leser) selbst bloßstellt. Der triumphale Abtritt von der Bühne bereitet insofern schon die Verstoßung des lächerlichen Charakters (dem dennoch die Sympathie des Erzählers gehört) im letzten Akt des Romans vor.
Nicht nur die Anspielung auf Molière setzt die Szene in einen absolutistischen Rahmen: Die erstgenannte »Gute Christen« (»Bon Chrétien«) war die Lieblingsbirne von Louis XIV, der sie in Versailles anbauen ließ; der »Bürgerkönig« Louis-Philippe wurde später von Honoré Daumier als Birne karikiert – zu Prousts Zeiten war »poire« als Bezeichnung für einen einfältigen Menschen gebräuchlich. In der Geschlechtersymbolik assoziiert die sich nach oben verjüngende Birne einen effeminierten, kraftlosen Körper, der in umso schärferem Kontrast zur absoluten Macht des höfischen Geistes steht, die Charlus hier beansprucht. Wie jener Szene, in welcher Marcel den ►Hut des Barons zerstört, liegt auch dieser ein minimales biographisches Ereignis zugrunde: Proust schildert, dass Robert de Montesquiou selbst bei einer Birnenbestellung seine literarischen Anspielungen nicht lassen konnte, und schreibt ihm das Molière-Zitat zu. Proust aß sehr gerne Birnen, die Céleste ►Albaret bei den besten Restaurants und Händlern von Paris für ihn beschaffte.
Freund und zugleich Lieblingsfeind des Erzählers, den er mit seinen schlechten Manieren, seiner Aufdringlichkeit und seiner Verlogenheit ständig provoziert. Zunächst lässt sich der junge Marcel von der Belesenheit und Welterfahrenheit des älteren Bloch beeindrucken – Bloch führt ihn in die Welt der Literatur ein, indem er ihm Bergotte zu lesen gibt, und in die Welt der Sinne, indem er ihn in ein Bordell mitnimmt –, später aber stört sich der Erzähler zunehmend an Blochs ►Snobismus und seinem politischen Opportunismus, der ihn in Balbec antisemitische Reden schwingen lässt, während er in der Pariser Gesellschaft für Dreyfus Partei ergreift. Auch Blochs literarische Erfolge, die er sich während des Krieges als Theaterautor erwirbt, haben ihr negatives Gegenstück in seinem Neid, der ihn die Erfolge Marcels nie anerkennen lässt. Obwohl Bloch alle Untugenden dieser Welt auf sich zu vereinen scheint, bleibt der ►Erzähler sein Freund, sucht trotz oder vielleicht wegen der ständigen Provokationen immer wieder seine Nähe und zeigt sich sogar betrübt, als die Freundschaft aufgrund eines Missverständnisses (an dem Albertine schuld ist) in Gefahr gerät.
Ein Schlüssel für diese merkwürdige ständige Anziehung und Abstoßung liegt in einem der frühesten Auftritte Blochs, als dieser bei Marcels Familie eingeladen ist und mit seinem durchaus originellen, aber auch unverschämten Verhalten alle vor den Kopf stößt: Auf die Frage des Vaters, wie das Wetter sei, antwortet er: »Ich lebe so entschieden jenseits der physikalischen Zufälligkeiten, dass meine Sinne sich nicht die Mühe machen, mich zu benachrichtigen«; die Großmutter hält ihn für manieriert, weil er auf ihre Bemerkung, sie fühle sich nicht wohl, ein Schluchzen unterdrückt, und die Eltern setzen ihn bei einem zweiten Besuch vor die Tür, weil er behauptet, die Großtante der Familie habe eine stürmische Jugend hinter sich – eine Annahme, die nach Marcels eigener Einschätzung durchaus berechtigt ist. Unabhängig von der moralischen Bewertung seiner Handlungen wird klar, welche Rolle Bloch hier für Marcel spielt: Er ist sein böses Alter Ego, der ungehorsame Sohn, der Vater und Mutter nicht achtet, die Familie verleumdet und verleugnet, hysterischen Anfällen ungehemmt ihren Lauf lässt und die höfliche Konversation über das Wetter verweigert – alles Dinge, die der gute Sohn Marcel nicht darf und auch nicht tut. Dies ist die Quelle der geheimen Anziehungskraft, die Bloch so beständig auf Marcel ausübt: Er tut das offen, was Marcel verdrängt; er tut stellvertretend das, was Marcel missbilligt, aber heimlich auch begehrt. Trotz der vernichtenden Urteile über seinen Charakter lässt Bloch den Erzähler öfter an den moralischen und ästhetischen Maßstäben seiner eigenen Erziehung zweifeln, ja lässt ihn manchmal sogar vermuten, der frivole Bloch könne der Welt von Kunst und Genialität näher sein als die von Mutter und Großmutter bewunderten Vorbilder: »Als wir nach dem Essen wieder oben waren, sagte ich zu meiner Großmutter, dass jene Eigenschaften der Madame de Villeparisis, die uns so sehr an ihr gefielen, ihr Takt und ihr Scharfsinn, ihre Diskretion und vornehme Zurückhaltung, vielleicht gar nicht so wertvoll waren, dass diejenigen, die sie in besonders hohem Maße besaßen, nur Persönlichkeiten wie Molé oder Loménie waren, und dass ihr Fehlen, selbst wenn es den alltäglichen Umgang unangenehm machte, einen Chateaubriand, Vigny, Hugo, Balzac nicht daran gehindert habe, zu werden, was sie waren, eitle Menschen ohne Urteilsvermögen, worüber sich leicht spotten ließ, wie Bloch … Aber beim Namen Bloch erhob meine Großmutter Einspruch. Sie pries Madame de Villeparisis.« Allein durch die Erwähnung von Blochs Namen kann der Erzähler hier seine Großmutter und das von ihr vertretene vornehm-feinsinnige Mittelmaß provozieren, ihn selbst inspiriert Bloch zu dem Gedanken, dass ►Kunst und Moral eben nichts miteinander zu tun haben – ein Befund, der sich wiederum bestätigt, wenn Proust dem »neuen Autor«, den der Erzähler so bewundert, die unsympathischen Züge Blochs verleiht.
Читать дальше