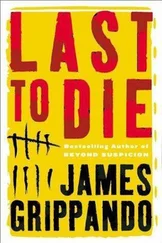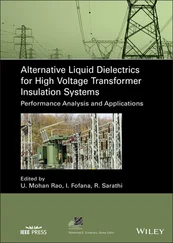»Das hast du dir sicher nur eingebildet«, hatte ihre Mutter gesagt, als ihr Ulla vor einigen Jahren erzählt hatte, was sie an diesem Abend gehört hatte. »Du sagst, du hättest auf der Bodentreppe gesessen. Aber was willst du denn von da gehört haben? Glaub mir, Papa war am Ende so schwach, dass selbst ich kaum hören konnte, was er sagte, und das, obwohl ich neben ihm auf der Bettkante gesessen und ihm die Wange gestreichelt habe.«
Aber sie hatte es gehört. Sollte ihre Mutter doch glauben, was sie wollte. Die Worte hatten sich in ihr Hirn geätzt, denn durch diese Worte war ihr klar geworden, dass ihr Vater sterben würde. Vorher pflegte ihre Mutter immer zu sagen »Lass uns damit warten, bis es Papa wieder besser geht«. Aber an diesem Abend war alles anders gewesen. Da hatte sie auf der Treppe gesessen und Mutter im Schlafzimmer weinen gehört, und zwischen den Schluchzern hatte sie sie sagen hören: »Ich bitte dich, Ståle, du darfst nicht sterben!« Sie war dort auf der obersten Treppenstufe beinahe erstarrt und hatte sich ans Geländer geklammert. Und dann hatte ihr Vater gesagt: »Weine nicht, Tora. Wir müssen jetzt endlich einen Strich ziehen unter all das, was wir nicht ändern können. Es wird Zeit, dass wir darüber sprechen, was geschehen soll, wenn ich einmal nicht mehr bin. Über dich. Und über die Kleine.«
Es war nicht dieser Teil des Gesprächs, den Mutter später leugnete. Es war das, was danach gekommen war. Gegen Ende. Nachdem sie über das Geld, die Rente, die Versicherungen und andere langweilige Sachen gesprochen hatten. Da, gerade als sie sich entschlossen hatte, wieder ins Bett zu gehen und zu schlafen, begannen sie zu streiten. Ulla war erschrocken gewesen, denn sie wurden nie laut, wenn sie miteinander sprachen. Warum also an diesem Abend? Am liebsten hätte sie geweint, so sehr schmerzte sie das alles. Doch stattdessen hatte sie gelauscht. Sie stritten über Vaters Krankheit. Mutter sagte, so etwas geschehe nicht rein zufällig. Das sei genauso wenig ein Zufall wie die Missbildung bei Ulla. Das sei beides das Werk des Herrn. Auf diese Weise zeigte Gott sein Missfallen an all jenen, die sein Wort nicht achteten.
»Nachdem du dich entschieden hast, trotz all des Teufelswerks den ›Freunden‹ die Treue zu halten, gab es nur noch Sorgen und Elend«, hatte Mutter gesagt. »Und ich muss jetzt die Zeche dafür zahlen. Mein Gott, was für ein Leben werde ich führen müssen!«
An dieser Stelle hatte Vater den Satz ausgesprochen, den Ulla niemals vergessen sollte. Sicher auch deshalb, weil sie nicht begreifen konnte, was er bedeutete. Doch in allererster Linie wohl, weil seine Stimme so stark und eindringlich geklungen hatte. Als wisse er, dass sie auf der anderen Seite der Wand auf der Treppe saß und lauschte. »Erzähl mir nichts vom Heidentum«, sagte er. »Meinst du, ich weiß nicht, was das ist? Ich kann dir sagen, Tora, ich habe gesehen, wie sich das Meer geteilt hat, und es war nicht Gottes Werk, was ich an diesem verfluchten Oktobertag im Jahr 1961 gesehen habe. Deshalb liege ich heute hier und schrumpfe zusammen. Also richte nicht Gott gegen mich, ja, und auch nicht gegen Ulla. Denn bei dem Ganzen dreht es sich um den Wahnsinn auf dieser Erde und nicht um unseren Glauben oder Unglauben.«
Genau so hatte er seine Worte gewählt. Sie hatte sie sich während ihrer ganzen Kindheit immer und immer wieder vorgesprochen, denn sie hatte große Angst davor, zu vergessen, was sie für eine persönliche Botschaft an sich selbst hielt. Trotzdem leugnete ihre Mutter, dass der Vater so etwas gesagt hatte.
Alles ließ sich erklären, daran zweifelte sie nicht. Mutter hatte bestimmt ihre Gründe dafür, sich nicht zu erinnern. Aber sie selbst wollte und konnte das nicht vergessen, und die Zeit näherte sich, in der sie auch nicht mehr würde schweigen können.
Doch zuerst musste sie herausfinden, was ihr Vater damit meinte, dass »sich das Meer geteilt habe«. Kein gottesfürchtiger Mann würde einen solchen Ausdruck ohne Grund auf seinem Sterbebett sagen.
»Ich habe gute Neuigkeiten«, sagte Doktor Adler. »Alle Ergebnisse sind hervorragend. Ihr Körper scheint Ihr neues Herz zu mögen. Es gibt keine Anzeichen einer Abstoßung. Noch ein paar Tage, und ich kann ›Entwarnung‹ geben und Sie gesundschreiben!«
Werner richtete sich auf. Er war im Laufe des letzten Tages deutlich frischer geworden und sehr optimistisch.
»Und wann darf ich hoffen, entlassen zu werden? Ich sehne mich danach, etwas anderes zu sehen als nur weiße Wände.«
»Zuerst einmal sollten Sie sich darüber freuen, dass Sie nicht sehen, was da draußen vor sich geht«, sagte Adler kurz. »Wir leben in einer geisteskranken Welt, Werner. Ja, vielleicht nicht da, wo Sie leben. Aber hier. Es ist wie in einer Irrenanstalt!« Er seufzte resigniert. »Und das ist mein Land! Mein Volk!«
Werner musterte ihn.
»Meinen Sie, dass auch Israel einen Teil der Schuld an dem Blutvergießen trägt? Dass doch nicht alles Arafats Schuld ist oder die seiner Nachfolger?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Adler ernst. »Das ist alles so kompliziert. Ich bin nur ein kleiner Herzchirurg und verstehe nichts von Politik. Aber wann hat man zuletzt einen Krieg erlebt, an dem nur eine Partei schuld war?«
Er trat ans Fenster und sah hinaus.
»Zum Glück sieht man von hier nichts von den Kampfhandlungen. Aber wir hören, wie sie sich gegenseitig umbringen. Inzwischen ärgere ich mich darüber, dass ich nicht ausgereist bin. In die USA oder nach Europa, wo meine Vorfahren über Generationen gelebt haben. Bloß, wo soll ich hin? Alle Angehörigen, die überlebt haben, sind hier – der Rest ist im Holocaust verschwunden.« Er drehte sich rasch um, als wolle er die traurigen Gedanken verscheuchen. »Was haben Sie vor, nachdem ich Sie entlassen habe? Sie müssen ja noch ein paar Wochen im Land bleiben. Wir lassen Sie erst nach der 4-Wochen-Kontrolle nach Hause fahren.«
»An die Mittelmeerküste«, antwortete Werner begeistert. »In der Nähe von Ashdod ist ein Hotel für uns reserviert worden. Zwei Wochen, nur Katarina und ich. Das werden die längsten gemeinsamen Ferien, die wir jemals hatten! – All das hat Doktor Schwartz arrangiert.«
»Ja, in ihm haben Sie wirklich einen guten Freund. Das merkt man in vielerlei Hinsicht.«
Etwas im Tonfall des Doktors ließ Werner aufhorchen.
»Denken Sie an etwas Spezielles?«
Adler zögerte.
»Ich weiß nicht recht, was ich sagen soll. Aber hier im Krankenhaus haben wir zu spüren bekommen, dass Dr. Schwartz ein Mann ist, der Ihnen Gutes will. Und der gewohnt ist, zu bekommen, was er will.«
»Wollen Sie damit sagen, dass Abby zu viel Druck auf Sie ausgeübt hat?« Werner verdrehte die Augen, als wolle er unterstreichen, welch absurder Gedanke das war. »Ich bin doch sicherlich nicht der erste Ausländer, den Sie operiert haben?«
»Nein, ganz und gar nicht«, antwortete Adler. »Aber die anderen haben warten müssen, bis sie an der Reihe waren, wie meine eigenen Landsleute zum Beispiel. Normalerweise behandeln wir alle Menschen gleich.«
Werner war verlegen.
»Wollen Sie damit sagen, dass ich eine Sonderbehandlung bekommen habe? Dass Schwartz geholfen hat, mich nach vorne zu mogeln?«
Adler setzte sich auf die Bettkante.
»Nein, Sie haben niemandem den Platz weggenommen.« Er schwieg, während er durch das Stethoskop lauschte. »Man kann eher sagen, dass Ihnen jemand ein Extraherz beschafft hat. Auf diese Weise konnten Sie außer der Reihe einen Termin bekommen.«
»Ich glaube, ich verstehe Sie immer noch nicht richtig. Was meinen Sie damit, dass mir jemand ein Extraherz beschafft hat? Das hört sich seltsam an.«
Adler stand auf.
»Ihr Herzrhythmus ist stabil. Keine Anzeichen für irgendwelche Komplikationen.« Er ging zur Tür. »Ich meinte das ganz einfach so, wie ich es gesagt habe. Dass es einer der unabsichtlichen Nebenaspekte eines solchen Krieges ist, wenn man vermehrten Zugang zu vitalen menschlichen Organen hat. Von jungen, starken Männern. Soldaten werden erschossen – manche sterben auf der Stelle, andere werden lebensgefährlich verletzt. Die Letztgenannten können uns nutzen. Werden sie rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht, können wir uns Nieren und Herzen sichern, ehe sie von uns gehen. So wird ihr viel zu früher Tod ein bisschen weniger sinnlos.«
Читать дальше