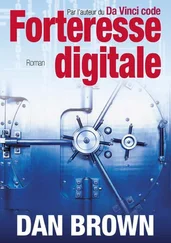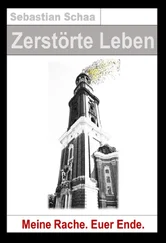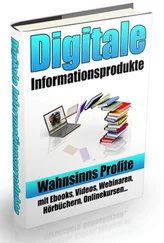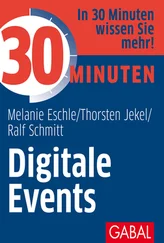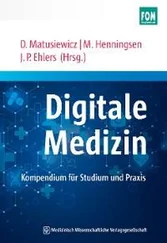Der Mensch schafft oder veranlasst zumindest die Innovationen, wodurch sich diese von der bloßen Dynamik abgrenzen lässt.267 Dies ist nicht erst im anthroposophischen Sinne zu verstehen, dass also nur der Mensch in der Lage wäre, innovativ zu sein. Vielmehr lässt sich bereits aus dem allgemeinen Sprachgebrauch entnehmen, dass andere Veränderungen oder Neuheiten solange keine Innovationen sind, wie sie nicht durch einen oder mehrere Menschen als solche durch einen kreativen Akt nutzbar gemacht und verwertet werden.268 Externe, also außerhalb dieses Schöpfungsakts stehende, Veränderungen der menschlichen Umwelt oder Gestaltungsmöglichkeiten sowie naturbezogene Veränderungen wie auch Mutationen sind zunächst keine Innovation. Innovation ist also nicht nur Resultat, sondern auch menschengemachter dynamischer Prozess, wie dies Holzweber zusammenfasst.269 Der Mensch kann sich die Dynamik des Wettbewerbs zu eigen machen, indem er Gelegenheiten wahrnimmt oder Krisen überwindet, und damit wiederum innovativ werden.270 Diese menschliche Schöpfung verlangt keinen Plan oder ein umfängliches Wissen der möglicherweise von ihr Berührten. Zwar können Veränderungen von Unternehmen geplant werden. Dies wird besonders bei denjenigen Unternehmen der Fall sein, die eine Veränderung anstreben oder umsetzen. Für andere Akteure wie zum Beispiel Nachfrager nach einem innovativen Gut oder Wettbewerber kann eine Veränderung dagegen unvorhergesehen auftreten.
„Erneuerung“ scheint dabei zunächst darauf hinzudeuten, dass Innovation ein Resultat eines Veränderungsprozesses sein kann.271 Innovationen sind aber stets vorübergehend und können lediglich einen unter den jeweiligen Umständen zu betrachtenden kurzweiligen Zustand abbilden, bis nämlich entweder die Innovation selbst wieder von einer anderen Innovation überholt wird oder aber nicht mehr als „Erneuerung“, sondern als „alt“, „etabliert“ oder ähnlich wahrgenommen wird. Deshalb kann es immer nur kleinere Resultate geben, die sich jeweils kurzzeitig die Bezeichnung als Innovation verdienen und nach einer gewissen Zeit diesen Titel abgeben müssen.
Allerdings wird wohl nicht jede bloße Veränderung als Innovation wahrgenommen. Einige Veränderungen könnten als niederschwellig anzusehen sein, weil es sich um einen Wechsel zu einem bereits vorher bekannten Zustand handelt oder zu offensichtlichen Alternativen. Auch graduell könnte die Veränderung als niederschwellig empfunden werden.272 Zudem ist zwar die Neuheit als solche wertneutral in Bezug auf das Vorhergegangene. Dennoch wird der Innovation überwiegend eine wohl positive Entwicklung zugesprochen.273 Im Vergleich zu dem vorherigen Zustand gibt es nicht nur etwas Neues oder eine Erneuerung, sondern auch etwas objektiv Besseres oder Fortgeschrittenes. Innovationsbezogene Veränderungen eröffnen bislang so nicht bekannte neue Entscheidungs- und Handlungsspielräume. Der Innovationsbegriff enthält damit eine weitere deskriptive Bedeutungskomponente im Hinblick auf diese Spielraumerweiterung.
Die Lösung eines Problems oder dessen logisches vorheriges Vorhandenseins ist dagegen nicht erforderlich. So scheint nach der Umschreibung von Hoffmann-Riehm das Problem die Grundvoraussetzung für Innovation zu sein, Innovation damit als Lösung für ein bestehendes oder sogar erst zu findendes Problem zusammenfassbar sein.274 Obwohl etwas als fortschrittlicher, bequemer oder in anderer Hinsicht besser empfunden wird, muss der vorherige Zustand nicht als alt, unbequem oder schlecht angesehen werden. Der Innovation kann stattdessen ein selbstständig für sich stehendes progressives Element zugeschrieben werden, das ebenso wie die Neuheit für sich allein als Ausdruck menschlichen schöpferischen Tätigwerdens steht.275 Dieses Für-sich-allein-Stehen des Fortschritts macht die Innovation gegenüber der Problemlösung so besonders. Denn nicht nur schlichte Problemlösungen werden als innovativ angesehen, sondern auch sonstige Erweiterungen alltäglicher Handlungsmöglichkeiten oder schlichte Trends.276 Vielmehr wird Fortschritt mit Kreativität verbunden werden können, also dem eigenständigen menschlichen schöpferischen und gestalterischen Tätigwerden., das im Wettbewerb durchgesetzt wird277 Dieses kreative Tätigwerden kann als Signifikanzschwelle angesehen werden, um banale Veränderungen von als Innovation bewertbarem Fortschritt abzugrenzen.278 Sie muss als solche wettbewerbliche Beachtung durch ihre Anerkennung erlangen.279 Der Schöpfungsakt macht also eine Innovation aus, wobei dieser nicht mit den durch außerhalb des Kartellrechts stehenden materiellen Schwellen wie zum Beispiel dem urheberrechtlichen Begriff der Schöpfungshöhe verwechselt werden darf. Allerdings kann eine Innovation selbst vermeintlich banal sein und dennoch auf ausreichende Anerkennung treffen.280 Auf diese jeweils relative Sicht kommt es denn in einem allgemeinen Verständnis des Innovationsbegriffs an, das Grundlage einer kartellrechtlichen Annäherung sein soll.281 Da nämlich eine Vielzahl an Entwicklungen als Innovation angesehen wird, müsste jedes Mal definitionsgemäß mindestens für einen logischen Augenblick bis zu seiner Entdeckung und Lösung durch die Innovation ein Problem bestehen.282
Neben der dynamischen und der progressiven Ebene der Innovation lässt sich ihr eine normative positiv-kompetitive Dimension entnehmen.283 Individuen streben nach Vorteilen gegenüber anderen, indem sie bessere Ausgangspositionen erhalten oder über mehr Kapazitäten verfügen können. Diese Vorteile haben einen sozialen und vergleichenden Bezug. Sie werden als Vorteile wahrgenommen, weil den Betrachtern, also Nachfragern oder Benutzern, der vorherige Zustand sowie die Veränderung und Entwicklung über einen Vergleich bewusst wird.284 Gleichzeitig wird ihnen neben den erweiterten Handlungsspielräumen eine zusätzliche Nutzbarkeit zugesprochen. Dies gilt besonders für die dargestellten Neuheiten und Entwicklungen in der Internet-Industrie. Einher mit dem Vorsprung geht also das Wissen über unterschiedliche Veränderungsarten oder –geschwindigkeiten und damit eröffneten unterschiedlichen Entscheidungsspielräumen.
Entscheidungsoptionen können dabei zum einen auf der unternehmerischen Entscheidungsebene liegen und zum anderen auf der Nachfrager- oder Nutzerebene. Unternehmer könnten sich im Rahmen einer Innovation veranlasst sehen, strategische Entscheidungen über Vertrieb, Preis oder Ausrichtung ihrer Produkte und Leistungen zu treffen, um hieraus Vorteile zu erzielen. Für Nachfrager kann der Vorsprung und das damit dargestellte Angebot als besonders begehrenswert erscheinen. Die Nachfrager könnten sich auf die Entscheidungen des Unternehmers einlassen oder sie mitgestalten, zum Beispiel durch die Verhandlung über Bedingungen. Für diejenigen ohne den Vorsprung könnte sich daraufhin ein Anreiz ergeben, ebenso Neuheiten zu entwickeln, die als Innovation eingeordnet werden, also den Innovator zu verfolgen.
d) Verdrängung und Exnovation
Neben dem positiv-kompetitiven Bezug hat der Innovationsbegriff eine negativ-kompetitive Komponente.285 Diese ebenso normative Begriffskomponente äußert sich in dem Risiko nachlassenden Interesses an nicht- oder nicht-mehrinnovativen Angeboten, aber auch in einem auf diese Bewegung abzielenden Auftreten der Unternehmen. Indem Unternehmen oder Nachfrager ihre durch eine Innovation erweiterten Handlungsoptionen ausnutzen, könnten sich diese Entscheidungen unmittelbar oder mittelbar auf andere, herkömmliche Angebote auswirken. Das nachlassende Interesse gegenüber diesen kann dazu führen, dass ein Angebot in seiner Präsenz bei den Nachfragern sinkt oder aber mit einer im Vergleich schlechteren Kostenstruktur für das jeweilige Unternehmen verbunden ist. Damit verbunden sind mögliche wirtschaftliche Nachteile für den Abgehängten. Diese können sich in einer Verdrängung von der vorherigen Position äußern, ebenso wie den vollständigen wirtschaftlichen Verlust der wettbewerblichen Stellung in einem bestimmten Segment. Dies kann zur Folge haben, dass sogar in der Wertung seiner Nachfrager vorher sehr hoch angesehene Produkte oder Leistungen nicht mehr nachgefragt werden. Die negativ-kompetitive Komponente der Innovation hängt also eng mit Pfadabhängigkeiten und ihrer Vermittlungsfunktion zusammen.286
Читать дальше