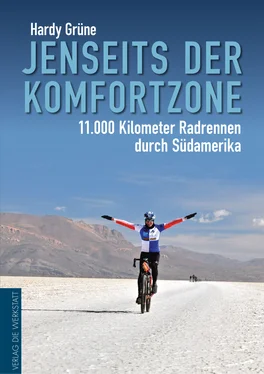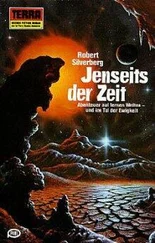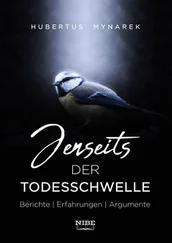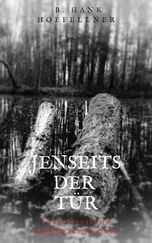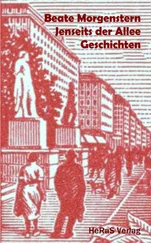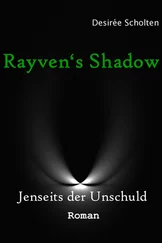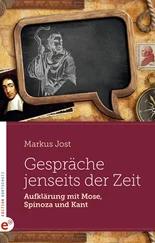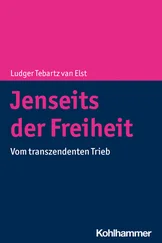Klingt paradox? Ist es auch! Bei einem kontinentalen Radrennen gibt es keine einfachen Wahrheiten. Nur die Essenz eines ganzen Bündels von Kompromissen. Normalerweise braucht man ungefähr ein Jahr, um einen Kontinent wie Südamerika zu durchradeln. Und hat sein ganzes Gepäck dabei. Wir dagegen rasen förmlich über den Kontinent. Viereinhalb Monate für 11.000 Kilometer – das macht ungefähr 100 Kilometer am Tag. Und fast jeden Tag ein neues Domizil, frische Eindrücke. Eine immense Herausforderung für Sinne und Seele, die das alles aufnehmen und verarbeiten müssen. Und doch ist es ein Geschenk. Vor allem an diejenigen, denen eine Jahrestour mit vollem Gepäck keinen Reiz bietet. Zu lang, zu störungsanfällig, zu einsam, zu viel Selbstkasteiung. Und für den einen oder anderen wohl auch zu gefährlich.
Ich mag zudem das Teamgefühl. Wir radeln als Kollektiv voller Individualisten. Konkurrieren einerseits miteinander, unterstützen uns andererseits aber auch. Manchem Abenteuerpuristen wird das zu wenig sein, zu wenig Konfrontation mit dem bereisten Raum und dessen Kultur. Doch genau das ist in meinen Augen ein Geschenk. Denn ein Abenteuer wie The Andes Trail lässt viele Möglichkeiten. Bietet Freiraum im Schutzraum. Man kann sich auf das Rennen konzentrieren und den Kontinent unbesehen durchrasen. Man kann sich auf das Eintauchen in den bereisten Raum einlassen und das Rennen als organisatorische Klammer sowie den Gepäcktransport als geschenkte Bewegungsfreiheit begreifen. Und man kann sich natürlich auch permanent in die Sicherheit der Gruppe und die Annehmlichkeiten des organisierten Lagerlebens flüchten. Also nur mal hin und wieder mit der Nasenspitze am Abenteuer nippen. Wie auch immer man es macht, die Rechnung gibt es erst zum Schluss. Wenn man wieder daheim ist und Rückschau hält. Erinnerungen sich zu Bildern formen, die Zufriedenheit auslösen. Oder Bedauern.
Ich jedenfalls sitze nun voller Zufriedenheit an einem Ort, der mir Nähe zu einem Kontinent verschafft, der mir nach etwas mehr als einer Woche auf dem Rad noch immer fremd ist. Die wichtigste Brücke zwischen den Menschen ist die Sprache. Wörter verbinden Lebenswelten. Ermöglichen den Austausch, schaffen Verständnis. Wer kommuniziert, ist nicht einsam. Ich probiere meine Spanischbrocken an den Damen aus, die mich mit herzhaftem Lachen und glitzernden Augenaufschlägen belohnen. Hocke mich auf die Terrasse, sauge die Bilder auf. Den halbverfallenen und vor langer Zeit geschlossenen „Salon Ana“ auf der anderen Straßenseite, vor dem ein Hund in sich eingerollt döst. Die steilen Hänge hinter uns, die den Blick grün verfärben. Die auf Funktionalität basierenden Lebensumstände. In Oña geht es nicht um optische Verführungen oder um das, was der Nachbar denkt. Hier liefert der Lebensalltag pragmatisch die Ausstattung. Keine angepinselte Scheinwelt wie in den Wohnsiedlungen Europas, sondern nüchtern-funktionale und ungefilterte Wahrheit. Das ist zwar auf den ersten Blick wenig attraktiv, tatsächlich aber reich an Erfahrungsmöglichkeiten. Wer nicht gerade als Bildungstourist unterwegs ist, ausgestattet mit enzyklopädischem Wissen über Kirchenbauten, Kulturepochen und Landschaftsgeografie, stets nur jene Bilder suchend und sehend, die ihm der Reiseführer vorgibt, für den kann Reisen das Blickfeld für alternative Lebensmodelle öffnen. Eine mächtige Herausforderung. Und eine gefährliche, denn sie führt hinaus aus der eigenen Komfortzone.
9. ETAPPE. OÑA – LOJA, 110 KILOMETER, 2.471 HÖHENMETER
Am nächsten Morgen hat die Durchfallwelle das halbe Team lahmgelegt. Lediglich 29 der 40 Teilnehmer klettern auf ihre Räder. Einige, die fahren, leiden ebenfalls unter Durchfall. So wie James, der Gesamtführende. Er will sich seine Rennzeit nicht verderben. Denn klettert er auf den Truck, bekommt er 12 Stunden Strafzeit aufgebrummt. Und verliert seine Poleposition. Schlimmer noch: Er verlöre den „EFI“. EFI steht für „every fabulous inch“. Also „jeder berühmte Millimeter“. Nur wer vom Start in Quito bis zum Ziel in Ushuaia jeden Millimeter auf dem Rad bewältigt, erhält am Ende den „EFI-Status“. Auf den vorangegangenen Touren war die Quote stets verschwindend gering. Zwar kann man sich für den EFI nichts kaufen, er ist aber dennoch Motivator für viele der Teilnehmer. Auch ich gehöre dazu. Denn angetreten bin ich mit drei Vorhaben: erstens überhaupt bis nach Ushuaia zu kommen. Zweitens möglichst die gesamte Strecke zu radeln, also den EFI-Status zu erhalten. Und drittens das Ganze auch noch ohne Durchfall zu überstehen. Ein ambitionierter Plan, wie sich herausstellen wird.
Während die Durchfallpatienten mit leidenden Gesichtern auf die Trucks klettern und ihre Räder auf die Dächer der beiden Begleitfahrzeuge geladen werden, hocken wir grinsend über dem Tagesprofil. Es sieht aus wie eine wildgewordene Börsenkurve. Viermal schnellt das Profil steil nach oben und steil wieder runter. Fast 2.500 Höhenmeter warten auf den 110 Kilometern auf uns. Schon nach wenigen Metern stehen wir im ersten Anstieg. Sieben bis acht Prozent für zwölf Kilometer. Ohne Pause, ohne Gnade.
Ich bin noch längst nicht warm und suche nach meinem Rhythmus. Steige immer mal wieder aus dem Sattel. Und hadere mit meiner technischen Ausrüstung. An meinem Crosser arbeitet eine Shimano 105 mit Dreifachblatt 50/39/30 und 11/28-Kassette. Was mich in Europa bequem jeden Berg erklimmen lässt, stößt in den harschen Anden an seine Grenzen. Mit der Übersetzung bin ich im Fahrerfeld alleine. Alle anderen fahren deutlich bergtauglichere Mountainbikekombinationen. Und kurbeln mit lässiger Gemütlichkeit, wo ich schon im kleinsten Gang arbeite und für jede Kurbelumdrehung viel Kraft aufbringen muss. Längst habe ich eingesehen, dass ich bei der Bestückung meines Rades einen fatalen Fehler begangen habe. Und die schroffen Anstiege der Anden fahrlässig unterschätzte. Dabei kommen die richtigen Giganten erst noch.

Immerhin: Die Kraft ist da, und so klettere ich durch eine vulkanische Säulenlandschaft hinauf zum ersten Pass. Der versteckt sich hinter einer Vielzahl von Kurven. Immer wieder glaube ich, am Gipfel angekommen zu sein. Doch es ist nur eine weitere Kurve, die bewältigt werden will. Irgendwann bin ich tatsächlich oben, streife die Windjacke über und stürze mich talwärts. In der Talsohle treffe ich einen einheimischen Radler aus Cuenca. Er ist auf dem Weg zu seiner kranken Mutter in Loja. Geld für den Bus hat er nicht. Also bleibt ihm nur das Fahrrad. Gemeinsam gehen wir in den zweiten Anstieg des Tages. Auf der scharfen Rampe ziehe ich jedoch schnell davon und erreiche Saraguró. Ein Marktort voller Alltagstohuwabohu. Lastwagen und Pick-ups streiten mit Eselkarren um die schmale Fahrbahn. Hunde flitzen durch die Gassen. Landbewohner treiben Kühe und Schafe vor sich her. Aufgeregte Kinder begrüßen mich mit „Gringo, Gringo“-Gelächter und laden ein zu einem zuckrigen Getränk, das sie mir für eine Handvoll Münzen überlassen. Vor mir sind bereits einige Mitradler durchgefahren, und die schlauen Burschen haben spitzbekommen, dass noch mehr von uns kommen. Und sie ein Geschäft machen können. Dankbar proste ich Ihnen zu.
Kaum habe ich das Marktgewusel hinter mir, stehe ich vor dem nächsten Menschenauflauf. Im örtlichen Stadion wird Fußball gespielt. Zwei Mädchenmannschaften. Erstaunlich für eine männlich dominierte Gesellschaft wie die Ecuadors. Ich hocke mich auf die Tribüne und schaue zu, wie die jungen Damen das Spielgerät geschickt über das Feld schicken. Irgendwann ruft die Pflicht wieder zur Arbeit. Drei dicke Anstiege warten noch auf mich. Beim Lunchstopp hinter dem zweiten Gipfel des Tages empfängt mich Freddy Mercury. „Is this real life? Or is this just fantasy?“, fragt er über die Bordlautsprecher. Zweimal bin ich von 2.100 auf über 3.000 Meter geklettert. Habe angesichts von Steigungsraten bis zu zehn Prozent zumeist in einstelligen Tempobereichen gekurbelt. „Is this real life? Or is this just fantasy?“ Eine berechtigte Frage.
Читать дальше