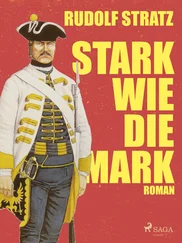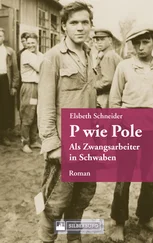Martin Siebenpfeiffer hörte die letzten Worte gar nicht mehr. Von einer inneren Gewalt getrieben, stieg er langsam wie ein Nachtwandler die Treppe hinan und stand, er wusste selbst nicht wie, vor dem Damenzimmer, von dessen oberem Türbalken ihm bei Schein des Flurlämpchens seine eigene, in grossen Zügen angekreidete Warnung vor dem Eintritt entgegendräute.
Selbstverständlich! Nicht in Gedanken wagte er es, sich der verhängnisvollen Türe zu nahen, die die Mirzl heute nachmittag im Schweisse ihres Angesichts heraufgeschleppt hatte. Und dennoch bewegte sich auf einmal, wie seinem Willen folgend, von innen die Klinke. Ein Spalt der Türe öffnete sich – in ihm erschien ein weisser Arm und setzte behutsam zwei spiegelndschwarze Dinger auf den sandbestreuten Boden. Dann verschwand er wieder, die Pforte schloss sich, der Schlüssel knarrte und alles war still.
Nur die beiden schwarzen Dinger blieben und schienen sich inmitten der Lake von Schneewasser, die sich sofort um sie verbreitete, neugierig umzuschauen. Und das war begreiflich. Denn es war sicher das erste und letzte Mal, dass ein Paar Lackstiefel den Boden der Törlihütte berührten ...
Zwei elegante Lackschuhe. Der Blick Martin Siebenpfeiffers hing gebannt an ihnen, und er nieste ein paarmal heftig, teils des Schnupfens wegen, teils aus nervöser Erregung.
Jetzt war ja kein Zweifel mehr. Was Ulrich Schneevogt vergeblich unten in den Tälern suchte, hielt sich hier oben vor ihm versteckt! Wie, warum und auf wie lange – das waren freilich düstere Rätsel.
Rätsel für den Vater der Törlihütte, in der sich schon am ersten Abend, noch vor ihrer offiziellen Einweihung, eine Katastrophe anzubahnen schien. Ganz betäubt stieg Martin Siebenpfeiffer nach langem Sinnen hinab ins Gastzimmer, wo seiner schon ein Kaiserschmarrn und eine dampfende Teekanne harrten. Er ass und trank ohne Hunger und Durst, er nieste zuweilen und sah starr zur Decke empor.
Dort hing still das Aufschneidemesser, im Lampenschein glitzernd, als warte es nur darauf, dem ersten Berglatein den Garaus zu machen. Aber das Wunder da oben war keine Lüge! Die Unbekannte war wirklich da. Man hörte, wie sie einmal mit leichten Schritten durch das Zimmer huschte und flehentlich nach der Veronika rief.
Sollte sie sich ein Leids angetan haben? Sich vergiftet? Martin Siebenpfeiffer stand unwillkürlich vor Schrecken auf. „Was will sie denn?“ fragte er beklommen die Veronika, die ins Zimmer trat.
„Eine Erbswurstsuppe hat sie bestellt“, berichtete die Kellnerin eilig. „Eine Portion Gulasch, einen Schmarrn und eine Flasche Rotwein. Sie hätte Hunger – spricht sie!“
Martin Siebenpfeiffer setzte sich wieder. Liebesgram war das wohl kaum! Dieser Heisshunger der Fremden zerstörte ihm das poetische Bild, das er sich bereits geschaffen hatte – das Bild eines bleichen jungen Weibes mit aufgelöstem Haar, das still die einsame Nacht hindurch in ihre Kissen schluchzt ...
Und statt dessen sitzt die junge Dame, wie ihm bald die wiederkehrende Veronika meldete, aufrecht im Bett, kaut unbekümmert mit beiden Backen, lobt den Rotwein und liest in einem Buche! Da hörte die Romantik auf!
Wie immer in seinem Leben! Wenn er schon den vorbeiflatternden Mantel der Fee Morgana erhascht zu haben glaubte, griff seine kleine, dicke Hand ins Leere und im Sturmwind verklang ein spöttisches Lachen.
Auch jetzt strich der Nachtwind ab und zu in gedämpftem Raunen die Törlihütte entlang, dass Martin Siebenpfeiffer es überhörte, wie die Veronika, in ein Tuch gewickelt, hinter seinen Stuhl trat.
Das Fräulein sei nun versorgt, berichtete die schwarzäugige Tirolerin. Für den gnä’ Herrn sei in seinem Zimmer oben auch alles gerichtet. Ob sie, die Veronika, sich jetzt auch zur Ruhe begeben dürfe? Der Kropf und die Jungfer Köchin hätten sich bereits zurückgezogen. Morgen sei doch ein anstrengender Tag.
Martin Siebenpfeiffer nickte nur. Die Veronika wünschte gute Nacht und ging.
Er sah auf die Uhr. Es war nach Bergbegriffen schon ziemlich spät – zwischen der zehnten und elften Abendstunde – und die tiefe Ruhe ringsum lud zum Schlummer ein. Aber in ihm fluteten und ebbten die Gedanken, und sein Herz klopfte. Es war doch zu seltsam – er da unten, sie da oben waren die beiden einzigen Gäste in dem einsamen, mondbeschienenen Bretterhaus hoch über der Menschheit. Denn die dienstbaren Geister – die zählten kaum mit! Die liessen sich höchstens durch eine Feuersbrunst aus ihrem totenähnlichen Schlaf erwecken.
Er da unten und sie da oben ... Das ging ihm nicht aus dem Sinn. Eigentlich empfand er eine Art Zorn gegen die Unbekannte! Wer so unbefangen – und noch dazu im Bette – zu Abend essen konnte, der hatte keine Seelenstürme zu bestehen! Der war überhaupt ein gefühlloses, materielles Geschöpf. Eine andere wäre verzweifelt wie ein wundes Reh hier hinaufgeflohen, um in der Einsamkeit der Berge still zu verbluten – die aber trank einen Kirsch, ehe sie sich schlafen legte, und schien sich einen Pfifferling um die Welt im ganzen und den zornmütig durch die Täler irrenden Ulrich Schneevogt im besonderen zu kümmern. Oder war das vielleicht gerade das Dämonische? Das schlangenhaft Kühle und Lauernde eines nixenhaften Wesens?
Eine Sphinx, die sich mit Gulasch und Kaiserschmarrn sättigt? Nein – das gab es nicht! Martin Siebenpfeiffer erhob sich wunden Herzens. Sein Idealismus hatte einen rohen Stoss erhalten. Unwillkürlich fiel ihm, während er von neuem heftig zu niesen anfing, seine Tante in Schrimm ein. Die war keine Sphinx, kein wildes Rätsel in nachtlokkigem Haar, sondern eine freundliche alte Jungfer und hatte ihm zu seinem letzten Geburtstag, als er wieder einmal über seine zerrissene Natur klagte, einen mit eigenhändiger Stickerei umrahmten Sinnspruch geschenkt:
„Geniesse froh, was dir beschieden,
Entbehre still, was du nicht hast;
Ein jeder Stand hat seinen Frieden,
Ein jeder Stand hat seine Last!“
Die Tante in Schrimm hatte zweifellos recht! Was man nicht hat, muss man entbehren! Was ging ihn, Martin Siebenpfeiffer, überhaupt dies gefrässige Rätsel im Damenzimmer an? Die schlief, und er wollte sich jetzt auch schlafen legen.
Eine eisige Luft schlug ihm entgegen, als er aus dem behaglich durchwärmten Gastraum auf den Flur hinaustrat. Das ganze neuerbaute und noch feuchte Haus dampfte förmlich vor Kälte, und von aussen her wehte durch alle Fugen und Ritzen der Frosthauch des nahen, von Firnschmelze erfüllten Törlisees und des darüber starrenden Gletschers.
Auch das Bett war feucht, wie aus dem Wasser gezogen. Er seufzte, legte sich in seinen Kleidern darauf, eine Wolldecke darüber hin, blies das Licht aus und versuchte zu schlafen.
Aber das hatte er den ganzen Nachmittag hindurch schon zu gründlich besorgt! Mit offenen Augen blickte er in die Finsternis, mit wachen Ohren hörte er das heute so merkwürdig unruhige Hämmern seines Herzens, das Klagen des Windes draussen ...
Und dazwischen einen anderen, ganz seltsamen Ton. Erst glaubte er an eine Sinnestäuschung. Aber nein – da klang es jetzt wieder – jetzt ganz deutlich und unheimlich – oben aus dem Damenzimmer – wie regellose Sprünge und dazwischen ein leises, fremdartiges Gelächter. Eine Weile war es still. Aber bald fing der Spuk von neuem an, wie wenn jemand da oben tanzte und krauses Zeug dazu kicherte.
Ein schrecklicher Gedanke durchzuckte den Oberlehrer! Wenn das des Rätsels Lösung war – eine Wahnsinnige, die man umsonst unten in den Tälern sucht und die inzwischen, der Aufsicht entronnen, hier oben Gott weiss was treibt! – Ganz deutlich hörte er durch die dünnen Bretterwände, wie jetzt dort oben ein Streichholz nach dem anderen angebrannt und wieder fortgeworfen wurde. Kein Zweifel – die Fremde war damit beschäftigt, zum Dank für die genossene Gastfreundschaft die Hütte anzuzünden – seine Törlihütte, sein Glück und seinen Stolz!
Читать дальше