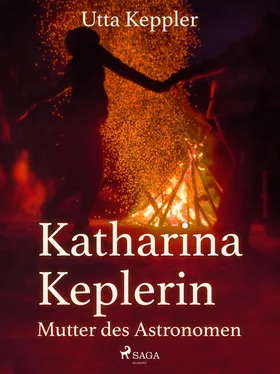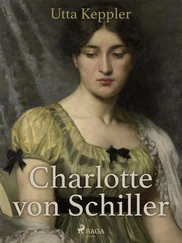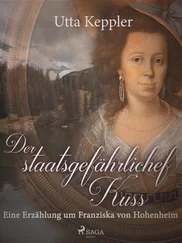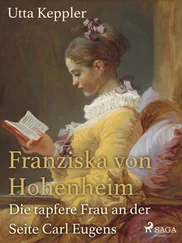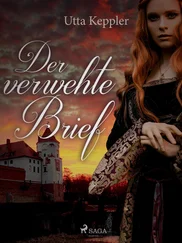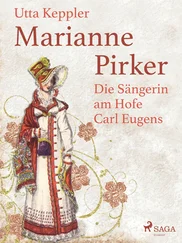»Was redet Ihr da, Beuttelsbacherin?« fragt Katharina entsetzt. Sie ist auf einmal weit weg, eine kleine armselige Katharina: Auf dem Anger im Wiesental steht das Kind. Der Morgennebel hat sich gesenkt, in langen Schlieren hält er sich über dem Gras, unter den hängenden Buchen ist es noch naß, der Morgen wird heller werden als die letzten Tage, Anemonen flecken die moosige Feuchte in Büscheln über dem schwarzen Boden.
Katharina friert. Sie hat ein dünnes Fähnchen an, leichte Schuhe, unter dem Häubchen hängen die schwarzen wuscheligen Haare in wehenden Strähnen um das Gesicht. Sie ist blaß, nicht nur, weil sie friert; sie steht und starrt hinüber, wo die welligen Wiesen sich hinter einer Mulde hügelig aufbäumen, bis zu einem breiten Rükken. Dorthin schaut sie und kann nichts deutlich erkennen.
Der Nebel hat sich jetzt verzogen, wie zerfaserte Schleierbänder wellt er über dem kurzen Gras, wird dünner, durchsichtig, glasig.
Aber droben am Hügel steht er noch, ein gelblicher Qualm hat sich gehalten, geduckt wie ein böses Nest. Es geht kein Wind, der ihn endlich auflösen könnte, er hockt da oben breit und hartnäckig. Katharina starrt noch immer hinüber.
Sie weiß, daß alles vorüber ist, es war auch weit genug weg, und man hat sie im Haus gelassen, solang es dauerte.
Sie krampft die Hände in die Schürze, stammelt irgend etwas, das sie selber nicht versteht, und schnüffelt in die Morgenluft. Kein Rauchdunst beizt ihr die Augen – davon haben sie geredet, als sie das Kind zurückhielten, das sei übel. Aber sie weiß schon, wie es gewesen ist. Sie hat einmal eine Maus brennen sehen, die man tot aus der Falle zog.
Und da, dort oben war’s die Base, die Base, bei der sie gewohnt hat und die sie gewaschen und gefüttert und ihr die Kleider genäht hat: Die Base hat brennen müssen.
Katharina wagt sich nicht näher an den Hügel, sie wagt sich auch nicht heim, was so »heim« heißt, das Lehrerhaus, wo sie jetzt wohnen soll.
Sie hat gehofft, die Base könnte fliegen und davonschweben, aber sie hat vom Fenster aus niemand auffliegen sehen, nicht aus dem Gefängnisloch, das sie umlauert hat, und nicht aus dem fernen Qualm …
Schließlich friert sie so in der Morgenkühle, daß sie zum Lehrerhaus trottet. Sie klopft ans Fenster. Die Lehrersfrau macht auf, einen Spalt nur, eine dicke rote Hand zieht den Riegel zurück.
»Wo warst denn die halbe Nacht?« fragt die Frau ärgerlich und mißtrauisch.
»Warum bist nicht in der Kammer?« sagt hinter ihr die Stimme des Lehrers. »Red’ endlich, Katharina Guldenmann!« Er guckt aus der Stube, ein langes Gesicht, lange Haare. »Herumstreifen, Wege unsicher machen!« Es klingt bös. Er schweigt und schiebt der kleinen Gestalt ein Stück Brot hin, das er gerade in der Hand hat. Mann und Frau schielen sie mißtrauisch an, sie spürt, daß sie das Ungreifbare, Verderbliche hinter ihr wittern, für das sie noch keinen Namen haben und das sie, die Arglose, nicht kennt und sehen kann. – Es hat nicht lang gutgetan bei den Leuten.
Dann später ist sie bei den Eltern gewesen, hat auf dem Acker geholfen, auch im Garten und im Haus, und als dann der Heinrich gekommen ist, der sie in der Wirtschaft ihres Vaters gesehen hatte, ist alles ein bißchen leichter geworden, schöner und freudiger, und sie hat manchmal gesungen.
Nur Heinrichs Mutter, die Statthalterin, hat sie nicht leiden mögen, obwohl Katharina doch ihren Namen trägt und sich um Heinrichs willen viel Mühe gibt.
Sie haben dann geheiratet, und bald schon hat sie gewußt, daß sie den Johannes erwartet, ein Kind halt. Hätten die Alten geahnt, daß es ein Bub wird, wären sie vielleicht auch nicht so finster gewesen, aber so haben sie ihr verübelt, daß es ein Esser mehr sein würde, und die Eigenen, die Guldenmännischen, haben’s noch schwerer genommen, daß sie jetzt bei den Keplerischen geholfen hat, und der eigene Vater hat sie geschlagen, auf den Rücken und einmal auf den Bauch, daß sie gemeint hat, das Kind müßte ihr abgehen. Es ist aber doch geblieben, es hat geboren werden sollen und sich vorzeitig ans Licht gedrängt – und jetzt ist’s der Johannes.
Johannes ist aus der Leonberger Lateinschule, wo er manche Prügel litt, in das Grammatistenkloster Adelberg gekommen – und überall wurde streng auf ein geschliffenes Latein gehalten, Griechisch und Hebräisch getrieben; für den jungen Kepler ist es ein Glück, daß er nicht mehr so nah bei der Heimat wohnt, da er allzu oft zum Helfen hergerufen worden war, beim Heumachen oder der Ernte, auf dem Äckerchen oder an den Apfelbäumen. Er hat willig geholfen, ist unter Vorwänden vom Unterricht weggeblieben; und beim Sicheln und Mähen, Breiten und Haufeln, beim Aufladen und Karrenschieben haben ihm manchmal die dünnen Arme versagt oder die Knie, und Katharina hat ihn ausruhen lassen im Schatten am Waldrand, oder ihn heimgeschickt.
Da hat er dann endlich das Schulheft herausholen und weiterlernen können. Ein unbezwinglicher Durst hat ihn dazu getrieben, geistige Neugier, sich alles anzueignen, logisch zu ordnen und zu durchdringen, was ihm da überliefert und – wie er es empfindet – verantwortlich anvertraut worden ist. Das treibt und drängt immer weiter.
Solang die Eltern die »Sonne« in Ellmendingen betrieben haben, hat er auch Fässer gerollt und hier und da im Schankraum Bier getragen, und dabei – zu seinem eigenen Erstaunen – das Landexamen bestanden, die schwerste und schwierigste Prüfung für sein Alter.
Er weiß freilich so wenig wie die Eltern, daß es sein Gutes hat, wie scharf die kleinen Buben hergenommen werden, und wie es ihm nachher hilft; es ist des Herzogs Ehrgeiz, die besten Lehrstätten weit und breit zu halten, und über’s Land hinaus gerühmt zu werden.
Im Grammatistenkloster zu Adelberg ist er wieder einer von den besten Schülern, ehrgeizig und manchmal auch vorlaut, wenn er klarer denkt als der Magister und den Mund nicht halten kann.
Die übrigen mögen ihn deshalb nicht alle, er hat auch einmal einen oder den anderen angegeben, der Unfug trieb, damit ihn die Lehrer nicht selber straften, da ihm die Prügel hart fielen bei seinem schwachen Körper. – Kurz ehe der Vater zum letzten Mal heimkommt – sie haben’s eher gefürchtet, wenn er da war –, bezieht er dann das höhere Klosterseminar Maulbronn und – so sagt der Abt –, wen die Luft der klaren Gliederungen, Torbogen und Hallen nicht wandle, dem sei nicht zu helfen.
Dort ist er jahrelang zu Haus, er fühlt sich aufgenommen ins Innere; der weite Hof mit den edlen Bauwerken ist – ohne daß er es weiß – Bild und Hinweis für ihn selber, magisch gestimmte frühe Gotik und schwingender Übergang zum erfaßbaren Neuen, und er gibt sich willig, da er doch auch Künstler ist, der Atmosphäre hin.
Katharina läßt ihm schreiben, sie werde ihn besuchen. Es ist mühselig, die Erlaubnis dafür zu erwirken, und nur der sichtlich bedeutsame Brief aus dem Feldlager und die Unterschriften und Siegel der Leonberger und Adelberger Schulen haben ihr den Zutritt verschafft, vielleicht auch der Hinweis auf den Statthalter von Weil und – die Leistung des Sohnes, den die Lehrer loben.
Jetzt ist sie wirklich da, im Seminar, in Maulbronn.
Sie muß warten; die Schüler kommen eben erst aus der Kirche, die in den Klosterkomplex eingebaut ist; auch ihren Johannes entdeckt sie und will ihn schnell an sich ziehen, als er an ihr vorüberläuft; aber er faßt nur nach ihrer Hand, rot geworden und dann blaß, er läßt sie los, schlägt die Augen nieder, als wolle er weinen, er schämt sich vor den anderen, daß er sie liebt; die dürfen nicht ahnen, wie groß seine Sehnsucht nach Zärtlichkeit ist. Dann rennt er den anderen Buben nach.
Sie bleibt stehen und sieht hinter ihm her; er ist ihr näher als ihre anderen Kinder, näher als die gestorbenen sogar, denen sie mit allen »Fasern« ihres Wesens nachtrauert; so hat sie einmal zum Heinrich gesagt, und der hat darüber den Kopf geschüttelt.
Читать дальше