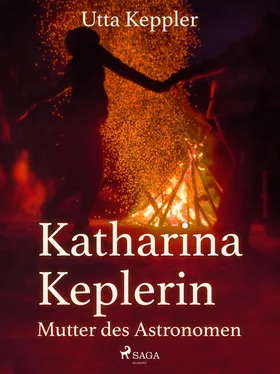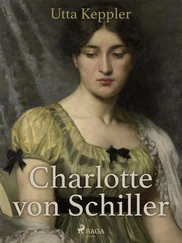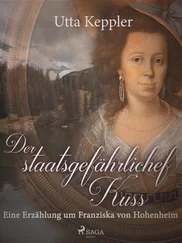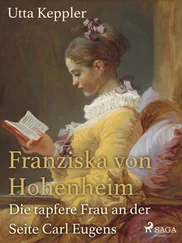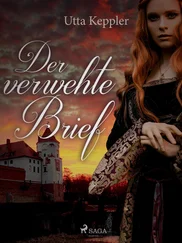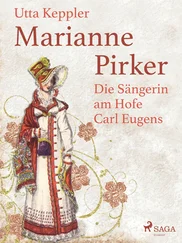Johannes ist in der Schule, der Lehrer bestellt den Vater zu sich, es sei etwas Besonderes mit dem Kerle, der sei heller als andere, habe eigene Ideen, sei schon jetzt ein Gelehrter, müsse geistlich werden …
»Geistlich?« brummt Heinrich; es fällt ihm ein, daß das Kind katholisch getauft und lutherisch erzogen ist – »geistlich?« Der solle das Wirtshaus erben, Bier holen und Holz tragen und Pferde füttern. Freilich, zu schwerer Arbeit tauge er ohnehin nicht, sei zart, schmächtig, schlage der Mutter nach; freilich, manchmal schon blitzgescheit, möcht’ sein, er brächt’s einmal zum Officierer, wie sein Vater, möcht’ sein, zu so einem Schreiber, neben dem Feldhauptmann, möcht’ sein, zu so einem Basteibauer und Pionier, möcht’ sein.
Er träumt, ist schon in Gedanken wieder im Feldlager, er verschwindet in einer grauen Nacht …
Katharina wartet wieder, sie wird gezankt und geschunden. »Wenn du den Mann recht hieltest, wär’ er schon dageblieben …«
Abends weint sie oft. Es ist, als wollten ihr die Augen ausrinnen, sie sitzt und starrt durch den Schleier, den irisierenden, den Nebel der Tränen.
Es ist ein später Sommer diesmal, ein paar kalte Nächte haben schon den Herbst hergerufen, denkt sie – es ist spät, spät …
Da hat ihr die Nachbarsfrau ein paar Rosen hereingestellt, dicke flache Rosen aus dem Bauerngarten; sie sieht sie an, und das Kerzenlicht scheint durch, da sind sie bläulich und purpurn, und ein grünlicher Schimmer ist in der Tiefe, wo sie sich auffalten um das Herz, und wulstig-rosa kreisen die schwachen zarten Blätter darum wie Fingerchen von einem Säugling, wenn er um den Daumen der Mutter herumgreift.
Rosen – denkt sie, das ist beinah’ nichts mehr für eine wie mich …
1584 wird eine winzige Margarethe geboren, aber es ist ein kräftiges Kind, und Mädchen, sagt man ihr, sind leichter durchzubringen als Buben.
Fast ist sie froh, daß der Heinrich nur noch selten da ist, sie weiß sich vor den Schwangerschaften nicht zu schützen, es ist ja ihr Mann, sein gutes Recht, längst nicht mehr Zärtlichkeit und Verlangen in ihr selber.
Er kommt noch einmal unerwartet heim und geht wieder. Drei Jahre nach dem Mädelchen kommt ein kleiner Christoph zur Welt – rundköpfig und stur und eigensinnig, aber die Geburt war leicht. Wenigstens hat keins der Jüngeren mehr die Fallsucht wie der Heinerle. Vielleicht hat ihn auch der Mann einmal geschlagen, als er unruhig war, der Vater getrunken hatte und schlafen wollte.
Den Bernhard, zwei Jahre danach, ein zartes Büblein, behält sie nicht lang und hat sich mit ihm arg quälen müssen.
Von ihrem Mann weiß sie nichts seit ein paar Monaten.
Da klopft es am Laden, ruft, sie kennt die Stimme kaum. »Heinrich!« schreit sie erschreckt, weil es so gequetscht und seltsam klingt. Sie reißt die Tür auf und sieht ihn hereintraben, einen dicken Schal um den Mund, der Kinn und Nase deckt; sie erkennt auch, daß er prächtige geschlitzte Hosen anhat, breit gefaltet, und ein Schwert an der Seite; draußen sei das Pferd, murmelt er, er sei »Leutenant« geworden. Den federwallenden Rundhut wirft er hin, erst dann fällt er breit auf die Fensterbank, zieht Katharina am Arm her, reißt den Schal ab, zwingt sie herum: »Die Augen auf, Frau!« und weist ihr grinsend ein rotes zerstörtes Gesicht: der Mund vernarbt, die Nase zerdrückt, zerrissen, die Augen – sie sieht es gleich und ist glücklich –, die hellblauen kleinen Augen sind noch unverstellt, aber der Bart ist schief aus der schrundigen Haut gesprossen, wie Pilzgeflecht.
»Heinrich!« Sie versucht, nicht zurückzufahren, stemmt sich gegen den Tisch, als er sie herzieht, und streicht ihm übers Haar, greift in die welligen Locken, die noch da sind.
Sie hält sich daran, senkt den Kopf gegen seine Schulter und drückt das Gesicht dagegen – so sieht sie nichts mehr.
»Was war das? Heinrich?«
»Du kennst doch Haubitzen und Feldschlangen, Kätterle«, sagt er weicher und führt sie zum Stuhl. »So ein Vieh ist krepiert, das Rohr hat’s verrissen, mir ins Gesicht die ganze Ladung und die Eisensplitter. Nicht einmal der Feind, die eigene Schlange war’s!«
Sie gewöhnt sich in den nächsten Tagen an das zerschundene Gesicht, das nicht mehr seines ist, und an die verbitterte rauhe Art, die er angenommen hat, das derbe brutale Protzen mit seinen Taten, das Überlegentun und Aufbrausen und die Gereiztheit, wenn nicht alles läuft, wie er’s meint.
Die Wirtschaft nutzt er nur noch zum eigenen Trinken, er jagt seine Frau herum vor den Gästen, als ihr Herr und Hauptmann und läßt sie spüren, wie wichtig er ist, ein »Officirer« und Sohn eines großen Herrn und aus einer hohen Sippe.
Zwischendurch läuft sie immer wieder die Treppe hinauf zu den Kindern, die im Winter in der oberen Stube von einer halbblinden Tante kaum recht beaufsichtigt werden; das Kleinste ziehen sie in einem Räderkarren durch den Raum, die Älteren streiten um Docken und Ball, und zum Glück – und Gott sei’s gedankt –, Johannes ist nicht bei ihnen, er darf in der Schule bleiben und beim Magister essen. –
Im Januar heult ein brüllender Schneesturm ums Haus, das Stalldach wird zerfetzt, das Stroh und die Schindeln wirbeln weit fort. Katharina hockt in der Küche und rührt im Brei. Heinrich ist drunten in der Wirtsstube und schaut nach den Gästen, schenkt mit der Magd aus und redet mit dem und jenem.
Katharina fürchtet sich – sie spürt im Sturm ein böses Wehen; etwas Nächtiges, meint sie, ziehe da herauf; der Laden schlägt, der Riegel ist gesplittert, es knallt und poltert gegen die Hauswand. Sie versucht, den flatternden Laden zu fassen und herzuziehen, aber der Sturm ist zu stark. Sie läuft hinunter in die Schankstube. »Heinrich, hilf doch! Der Wind – es drückt droben die Scheiben ein – komm!«
Heinrich steht auf, er hat mit einem Kaufmann getrunken, der Verbindungen nach Venedig haben will, das ist dem Heinrich wichtig. Katharina drängt; er läuft zur Tür, verspricht noch vom Treppenfuß, wiederzukommen, ist mit großen Sprüngen über die Stufen und reißt droben das Fenster auf, biegt sich hinaus und zerrt am Laden, gegen den Sturm.
Da klirrt es, er fährt schreiend zurück – mit dem Ellenbogen hat er die Scheibe eingedrückt, – er blutet. Den Laden zwingt er her, klemmt ihn fest, taumelt in die Stube zurück. »Weib, so tu doch auch mit!« schreit er und stülpt den bunten Ärmel auf – »das schöne Gewand!«
Sie rennt mit einem Lappen und verbindet ihn erschreckt. Sie sieht das Rote in seinen Augen, hört die heisere Stimme und weiß, daß ihn wieder die sinnlose Wut gepackt hat, die sie kennt, der Wahnsinn, in dem er alles zerschlagen und zerreißen muß, was ihm entgegen ist. Sie weicht aus, geht auf die Tür zu, rückwärts zur Stiege; erst dann wagt sie, sich umzudrehen, sie geht langsam hinunter.
Oben ist es jetzt still, um den Ofen im Schankraum lärmen die Gäste; die Kinder hört sie nicht. Wenn er wie ein Stier bei denen eingebrochen wäre, hätt’s ein Unglück gegeben …
Dann beugt sie sich aus dem Flurfenster, das zum Hof geht, und horcht zitternd hinaus. Der Wind hat sich gelegt; verblasen, verrauscht ist er; Katharina hört deutlich die Tritte am Schuppen, die Stalltür knirscht, das Trappen des Gauls hört sie, sieht, wie Heinrich den Sattel auflegt und den Mantelsack festschnallt – er muß alles schon lange bereitgehabt haben.
Sie hört das Tier schnauben, jetzt, jetzt müßte sie ihn rufen, sie versucht es, aber bloß ein schwaches Keuchen gelingt ihr.
Sie läuft zu den Kindern, die vom Wetter verängstigt beieinandersitzen, sie nimmt sie in die Arme, breit umfassend, und drückt sie an sich, Heiner, die dicke Margarethe, den schmächtigen Sebald und das Kleine.
Heinrich ist fort – wieder einmal. Er hat unterwegs den Kaufmann getroffen, der ihm Dienste bei den Venezianern versprochen, ihm auf den Weg geholfen und sogar ein Angeld gegeben hat; der Arm blutet ihm noch durch das Leinen.
Читать дальше