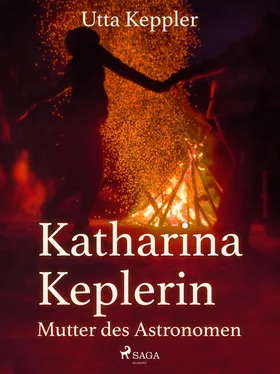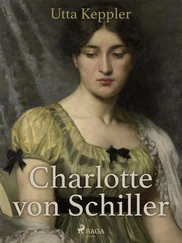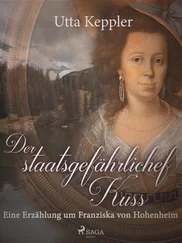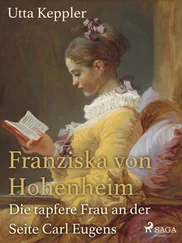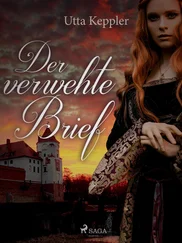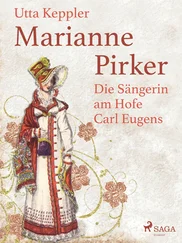»Ich hab’ deinen Vater oft vor mir gesehen und ihn gerufen, wenn ich es fest wollte, ich sah sogar, wo er gerad’ war – aber ich hab’s kaum einem erzählt.«
Johannes wird unruhig. »Tut das auch nicht, Frau Mutter, Ihr wißt nicht, wie übel die Leute denken, ich …, ich hab’ Angst um Euch, wenn Ihr so redet.«
»Du brauchst um mich keine Angst zu haben, Hannes«, flüstert sie, »ich lern’ es jeden Tag, wie man sich wehren kann und muß – immer besser lern’ ich’s«, sie zögert, »seit der Vater mich alleingelassen hat.«
So hat sie noch nie gesprochen.
»Ja, Mutter, ich weiß schon, aber …«; er besinnt sich, sagt dann betonter: »Wir sind die Schwachen, so, ohne Vater und ohne Geld, und wer’s schlecht mit uns meint, kann uns verderben, und wär’s bloß mit wüsten Reden.«
»Was können sie uns nachsagen, Kind? Wir sind ehrlich und frei, und kein übler Leumund hängt uns an.« Er sieht auf und schüttelt den Kopf. »Ich hab’ gehört, sie wühlen wieder – verwirrte, halbkranke Gemüter – meinen, die Unholden gingen um, man müsse auf der Hut sein; ach! Sag’ kein Wort, das sie dir verdrehen und verdeuteln können.«
Er beißt sich auf die Fingerknöchel, preßt die Lider zusammen. »Ich darf dir nicht helfen, Mutter, hier ist mein Platz, und – Gott hat mich’s geheißen, daß ich das Studium weiterführen soll.«
Sie seufzt.
»Hüt’ dich, liebe Mutter«, flüstert er gequält, »es treibt mich so um, wenn ich fürchten muß, man hängte dir was an – weißt doch: Die arme Bas! Und so ein Verdacht – ach, Mutter, das könnt’ mich einmal das Amt kosten, so ich’s endlich erreicht hätt’!«
Anderntags muß sie reisen, die Wirtschaft und die Kinder brauchen sie, der Heiner ist jetzt dreizehn, immer noch »stumpig«, wie sie in der Nachbarschaft sagen, und seine Anfälle und »schäumenden Krämpfe« hat er jetzt sogar mehr als früher; Margarethe gedeiht, ein rundes, kräftiges Mädchen.
Katharina dankt dem Abt noch einmal, sie gibt Johannes die Hand und beruhigt ihn – sie wolle ihn nicht drängen zum Heimkommen –, vielleicht, wenn alles vorbei sei und er ein Pfarramt angetreten habe, werde es ihr leichter gemacht, man gewinne auch Ansehen damit, und nicht bloß durch den Großvater. Er lächelt trüb – am nächsten Morgen werde er sie noch einmal sehen, sagt er.
Ein Wagen ist schon bestellt, der sie heimbringen soll. Sommermorgen, die Felder sind blaugrün im Tau, es ist noch kühl, sie denkt an den Sohn zurück, an seine Warnung vor den bösen Gerüchten und dem dummen Klatsch, sie wehrt sich gegen das Unklare – und Heinrich? Ach, der hätte ihr auch nicht viel beigestanden, hat ihr von je das Erhalten und Zusammenhalten aufgebürdet und ist wie ein Bub dem bunten Fahnentuch nachgelaufen; und der Sohn, den sie so gern hat – der läuft seiner Wissenschaft nach, seinen Spekulationen, die sie nie verstehen wird, das weiß sie –, Berechnungen und Glaubenssätzen, griechischen Formen und lateinischen Formeln, was soll’s? Gott spürt sie, den braucht sie nicht zu ergrübeln, so nicht, wie die Gelehrten es tun, und nicht mit der dürren Bangnis etlicher Kirchenmänner, und auch nicht mit Beschwören und Gemurmel, das die Leute von ihr wollen.
Das ist ihr höchstens einmal unterlaufen, wenn sie einem Sterbenden den Trost hat geben wollen, den er verlangt hat – und sie hat dabei gedacht: Herr, Heiland, hilf ihm, und wenn’s nur mit meinem verzweifelten Willen ist …
Johannes, der kluge Rechner, der hat Angst vor dem Hexengerede. Und sie? Seit die Base hat sterben müssen, weiß sie doch, daß das ganze Wesen und Meinen wie ein krankhaftes Geschwür ist, Geschwür im Innersten, das man nicht wuchern lassen darf, um der armen, armen Base willen, um der vielen schreiend gequälten Weiber willen; sie kann’s nicht glauben, daß die alle bös waren; nur dumm waren sie, verscheucht, verängstigt, beredet und übertölpelt … Sie schaut wieder über die Felder, während der Wagen rattert, zieht ihr Tuch enger um sich, der Wind kommt stärker auf – die Fahrt wird noch lang dauern …
Da holt sie ein Reiter ein, sie treibt den Fuhrmann an, weil’s ein Straßenräuber sein könnte; dann erkennt sie den Frischlin, den Versemacher und Latinisten, der sie, schon rückwärts gewendet, anlacht und den großen Hut schwenkt.
»Frau Keplerin!« ruft der Reiter, der diesmal in einem kurzen braunen Habit steckt, mit hohen, umgestülpten Stiefeln, einen Radmantel mit aufgeschlagenem Kragen umgehängt, der einseitig schief den langen, breiten Bart zudeckt.
Katharina muß lachen, aus allen trübseligen Gedanken heraus. »Herr Professor!« ruft sie hinauf, da er das Roß gezügelt hat und neben dem Wagen in Schritt fallen läßt. Sie fragt ihn, ob er denn nicht lang vor ihr abgereist und wo er aufgehalten worden sei? – Der Fuhrknecht kennt den berühmten Mann und hält.
Frischlin erzählt, er sei auf dem Weg nach Stuttgart zum Herzog und am Vorabend in einer Kneipe hängengeblieben, unabsichtlich, aber ganz erwünscht.
Sie lacht wieder, es wundert sie, daß der Dichter sie so vergnügt macht, wo doch alles so düster ist, wenn man’s recht ansieht. Dann fragt er, ob er ein Stück Wegs mitfahren dürfe im Wagen, er habe ja fast denselben Weg, und den Gaul könne er vorschirren, wenn sie gestatte.
Aber so viel versteht Katharina von Wagen, Deichsel und Pferdezügel, daß man nicht einfach einen zweiten zum einzelnen Gaul anbinden kann; sie sagt ihm das, und der Fuhrmann fuchtelt aufgeregt, weil er seine Zeit eingeteilt hat und nicht so viel mit dem Gerede vertun mag.
Frischlin gibt ihm Geld und vertraut ihm sein Pferd an, setzt sich zu Katharina in die offene Fuhre, und der Kutscher reitet hinterdrein – sie läßt es zu bei allen Bedenken.
Frischlin nimmt die Zügel und zottelt los.
»Ich hab’ lachen müssen, Herr Professor«, sagt sie nach einer Weile schüchtern, »und muß mich entschuldigen deswegen.«
»Warum habt Ihr gelacht, Keplerin?« fragt er, eher belustigt als erstaunt. »Meinethalben? Hab’ ich so verwegen ausgesehen?«
»Ja, auch. Aber Ihr habt mich vergnügt gemacht, wo ich arg traurig war.«
Er fragt natürlich, was sie drücke; sie erzählt ihm von dem Brief und zeigt ihn vor. Frischlin hält das Pferd an, brummelt vor sich hin, als er die Unterschriften entziffert, vergleicht auch den genannten Ort und das Datum und fragt dann, ob denn der Mann, ihr Eheherr Heinrich Kepler, bei des Scherberg Truppe gewesen oder woher sie das letztemal Botschaft bezogen habe? Sein Ton ist verwirrend, spöttisch oder überlegen, meint sie, oder unsicher.
»Nichts davon weiß ich, der Name, den Ihr da leset, ist mir neu.« Einen Augenblick denkt sie, der Dichter, der ihr die Mitfahrt aufgedrungen hat und sein Pferd nebenher vom Fuhrknecht reiten läßt, wäre ein zudringlicher Mann; derartiges Gerede ging ja um – und er wolle sie gern glauben machen, Heinrich wäre verdorben und verschollen.
Aber als sie ihn von der Seite ansieht, ist er so breit und bieder, wie’s nur sein kann, und sie tut ihm innerlich Abbitte. –
Im Brief – er muß zwischendurch auf die Straße achten, die jetzt abbiegt – ist von einem Leibtrabanten die Rede; er liest es ihr vor, und da fällt ihr ein, wer gemeint sein könnte … Die Nachricht käme aus Hungaria, erklärt er zwischendurch, ob ihr Mann da gewesen sei?
»Der Vetter, Herr, der Vetter Friedrich aus Weil der Stadt, der ist elf Jahr jünger als der Heinrich, könnt’s der sein?«
»Möglich«, murmelt der Briefleser, »sehr möglich.« Dabei schaut er wie verschlafen in den Himmel, der jetzt sonnenflimmrig blitzt und scheint, Katharina denkt erschrocken, er dichte, wäre nicht ganz bei der Sache und beim Fahren, und – wer weiß – habe vielleicht Gesichte.
Aber sie faßt trotz ihrer Schüchternheit nach seinem Arm und fragt eindringlich: »Ist’s gar nicht der Heinrich?«
Читать дальше