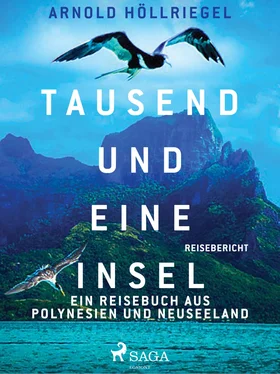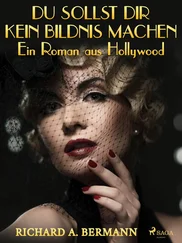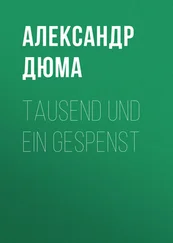Er kriegt ja endlich doch einen Whisky, einen kleinen nur, und wird auf einmal gesprächig. Ich liege auf dem Bauch, das Kissen unter mir, und schreibe manchmal in mein Notizbuch. Der Mann ist ein Konversationslexikon.
„Wett’ dein Leben,“ sagt er, „Fidschi ist gutes Land. Wir hier in Mbau nur Häuptlinge, Häuptlinge und Frauen und Kinder und Diener. Kinder? Ich ob Kinder habe? Wett’ dein Leben! Vierzig Kinder! Missionär sagt: ‚Viele Frauen, nicht gut.‘ Ich heirate eine Frau, andere Frau in andere Haus, viele. Das Fidschisitte.“
Er runzelt sorgenvoll die Stirn. „Missionär nicht gut,“ sagt er. „Nimm an etwas Fidschisitte, er sagt: ‚Nicht gut, gehst Hölle.‘ Ich rechne, ich bald gehe anderen Missionär. Romkatholisch gutes Stück viel mehr besser, wett’ dein Leben!“
Er spricht so, in dem Strandenglisch der aussterbenden alten Generation, und man kann ihn leicht ein wenig komisch finden, wenn man zu stumpf ist, um zu verstehen, wie vornehm der Mann im Grunde ist, wie sehr ein wirklicher Aristokrat, einer der letzten vielleicht, die diese Erde trägt. Vielleicht ist diese Insel Mbau, das Schutzgebiet der grossen Häuptlingsfamilien von Fidschi, heute die letzte sichere Zufluchtsstätte adeligen Wesens.
Halb aufgerichtet auf seinem Trinklager aus köstlichen Matten, zeigt der alte Häuptling auf diese festliche Halle, auf die sklavisch hockenden Chöre der schönen Mädchen, der starken Jünglinge, auf dieses Halbdunkel, aus dem die leisen Gesänge kommen, und er erklärt mir hochmütig, dass diese schöne Halle keineswegs nur ein Schlafraum für vazierende Schriftsteller ist.
„Dieses Haus unser Haus der Lords,“ sagt Ratu Bola. Er meint, dass die Halle an der Stätte des uralten Tempels eigentlich der Ratssaal der Edlen von Fidschi ist. Einmal im Jahr kommt der britische Gouverneur von Fidschi nach Mbau; man begrüsst ihn mit einer grossen festlichen Meke, mit Liedern und Kriegstänzen auf dem grünen Platz vor dem Hause; dann aber sitzt der Gouverneur hier in der grossen Bure mitten unter den Häuptlingen, und sie sprechen zu ihm, sagen ihm, was sie wünschen.
„Und was uns nicht gefällt,“ sagt Ratu Bola und wirft seinen grauen Kopf trotzig zurück.
O Meisterschaft, denke ich, der englischen Politik! Sie haben den Eingeborenen in Mbau eine Art Scheinkönigreich gelassen, eine Republik von grossen Häuptlingen, in die kein Polizist den Fuss setzt; da sitzen die vierzehn stolzen Enkel der Inselfürsten, hübsch beisammen — —
Unterdessen erschliessen auf den grossen Hauptinseln elende indische Kulis die weiten Plantagen.
In Mbau aber ist alles, wie es war, und bleibt alles, wie es war, höchstens, dass keine Menschen mehr gefressen werden. Es ist wahr, der Missionar lebt auf der Insel, und er legt Wert darauf, jeden Häuptling mit einer seiner Frauen feierlich zu verheiraten, in der kleinen Kirche, vor der ein gehöhlter Baumstamm liegt, die Trommel, die einst zu Kannibalenfesten rief und jetzt zum christlichen Gebet ruft. Man heiratet eine Frau und hat ein paar Dutzend andere in netten kleinen Hütten. Nur diese Familien der Häuptlinge wohnen auf der Insel Mbau; ein Gemeiner von geringem Blut betritt diesen heiligen Boden nur, wenn ihn der Häuptling gerufen hat. Was der Häuptling zum Leben braucht, lässt er sich einfach kommen. „Geh auf Festland,“ befiehlt er dem ehrfürchtig hockenden Diener, „bring’ Fisch! Bring’ Taro! Bring’ Feuerholz!“ Der gemeine Mann geht und bringt.
„Sieh,“ sagt der Ratu und streckt mir seine schlanken braunen Hände mit den hellen Nägeln entgegen. „Sieh, diese Hände — — wett’ dein Leben, ganzes Leben nicht einmal verdammt gearbeitet!“
„Auch nicht schreiben wie weisser Mann,“ sagt er mit einem verächtlichen Blick auf meine eigenen Hände. Er hat mich offenbar im Verdacht, dass ich gar kein so grosser Kazike bin.
Er spricht und spricht, laut und rücksichtslos, in den lieben Gesang der Knaben und Mädchen hinein, der nicht aufhört. Er entrollt mir das Bild einer feudalen Gesellschaft, in der der Fürst, der edel Geborene, sich von seiner Matte niemals erhebt, es sei denn zu Spiel und Sport und Krieg. Die Schlachtkeule zu schwingen, und wenn sie nicht mehr geschwungen werden darf, dann den Kricketschläger, ist eines Ratu würdig, oder allenfalls das Segel des Auslegerboots zu entfalten. Die Niederen, die Koigu, mögen auf die Bäume klettern, um Kokosnüsse zum Trinken! Ihnen geziemt es, vor dem Häuptling zu hocken und ihm den geflochtenen Korb mit der besten Speise zu reichen.
„Fidschisitte,“ sagt der Ratu mit grossem Nachdruck. Er ist ein Konservativer, das ist mal gewiss.
Ich frage, ob an diesem Glanz, dieser Herrlichkeit auch hochgeborene Frauen den gleichen Anteil haben. Aber der Ratu lacht nur zynisch.
„Nix Ladies,“ sagt er. „Ladies bei uns niemand schert sich. Wenn mein Grossvater sterben, zehn, zwanzig Frauen hängen sich auf. Nix wert, Frau!“
Dieser Grossvater, von dem Ratu Bola immer wieder mit grosser Pietät zu reden anhebt, muss überhaupt eine interessante und liebenswerte Persönlichkeit gewesen sein. Er ass ganz weiche zarte Säuglinge viel lieber als ältere und vom Leben vergiftete Menschen. Der Vater Ratu Bolas hat als ein Kind manchmal einen Knochen zum Abnagen bekommen, aber später hat er die Diät gewechselt, und Bola selbst hat natürlich niemals Menschenfleisch zu kosten bekommen.
Die Ansichten dieses gediegenen alten Torys über die soziale Frage sind einfach, ehrlich und gar nicht so exotisch.
„Wett’ dein Leben,“ sagt er, „Fidschisitte gut für Häuptling. Nimm an, Fidschiboy, nicht Häuptling, auch gut. Er macht Arbeit, ich gebe viel Taro. Er nicht macht Arbeit, er Hunger...“
Wo, beim dreiköpfigen Gott von Mbau, habe ich gutgenährte Häuptlinge schon so reden gehört?
Spät in der Nacht, sehr spät. Der ältere von den Häuptlingen hat meine Geschenke verteilt, mit der ruhigen Würde eines grossen Patriarchen. Er hat von den Sängern, den Tänzerinnen diejenigen zu dem grossen Tisch gerufen, denen er seine eigene Gunst beweisen wollte, und demütig hockend, mit niedergeschlagenen Augen, haben sie in Empfang genommen, was er von meinen Gaben ihnen zuwenden wollte, Stoff auf ein Kleid oder einen halben Meter Tabakwurst oder eine Flasche von dem Eau de Cologne des Apothekers Brown, der schon seit so vielen Stunden in einer Ecke des Raums seinen Rausch ausschnarcht. Ich habe beobachtet, dass eine von den drei schönen Tänzerinnen lieber ein Stück von dem roten Stoff haben wollte als von dem blauen, und ich habe ihr das Stück selbst abgeschnitten; zu spät bemerkte ich, dass ich die Etikette gröblich verletzt habe, die Verfassung der Insel Mbau, die will, dass alle Gunst und Gnade und jegliches Gut des Lebens aus der Hand des Edelings komme, des Herren und Häuptlings. Nun sind die Sänger fort. Die beiden Häuptlinge haben, fern von mir in einer Ecke, noch lange halblaut miteinander gesprochen; jetzt sind sie fort. Ich habe den Verdacht, dass Ratu Bola eine Whiskyflasche mitgenommen hat. Ich bin zu müde, um zu zählen.
Ich liege auf den Matten, mit meinem Regenmantel zugedeckt. Ein Bett mit einer Sprungfedermatratze ist immerhin noch besser, besonders, wenn ein Moskitonetz dabei wäre.
Ich sehe durch die grosse Türöffnung den Sternenhimmel. Es ist herrlich kühl, es duftet nach Regen, Gras und den weissen Blüten des Frangipanibaums. Ich höre lange nichts als das Zirpen der Zikaden, das Singen des Moskitos neben meinem Ohr und einmal einen seltsamen Vogelschrei.
Ich kann noch lange nicht schlafen, der Moskitos wegen, und weil Mister Brown so schnarcht und weil ich auf einmal so deutlich dieses Fremdsein empfinde, die beunruhigende Seltsamkeit dieses Nachtlagers im Hause der Lords von Fidschi, auf dem Boden, der mir noch nach dem Blut menschlicher Opfer zu riechen scheint und nach unbekannten Emanationen eines grauenhaften und dreiköpfigen Gottes.
Читать дальше