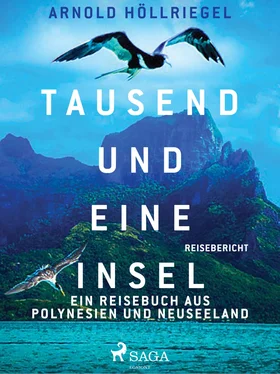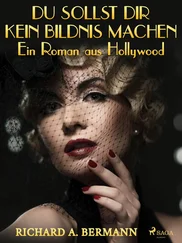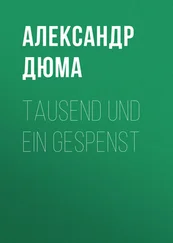Wie mich der alte Tui in dieses schöne Haus führt, empfinde ich sogleich jene besondere Atmosphäre königlicher Paläste und wundere mich nicht, dass ich sofort einer Prinzessin vorgestellt werde. Es ist die Kusine Ratu Popes, wie er ein Abkömmling des letzten unabhängigen Königs von Fidschi, Thakombau. Der alte Kannibale hat im Jahre 1884 ungemein freiwillig seinem Thron entsagt, zugunsten der Königin von England und gegen Zusicherung einer Pension von 2000 Pfund und auch einer Dampfjacht. Der Titel des alten Thakombau, „Tui Viti“, König von Fidschi, hat sich auf seine Nachkommen nicht vererbt; eine Königstochter hat in der Sprache von Fidschi nie irgendeinen Titel gehabt, dennoch nennt jedermann diese Frau, die mich jetzt im Haus ihres Vetters empfängt, eine Prinzessin. Die Prinzessin Andi Thakombau trägt einen roten Kittel, der lose von mageren Schultern hängt. Sie hat sich von der kleinen Nähmaschine erhoben, neben der sie hockte. Jetzt streckt sie mir eine schöne, beringte Hand entgegen und lächelt. Ihr alterndes Gesicht zeigt nicht die melanesischen Negerzüge der Leute von Fidschi; ihre Mutter war eine Fürstentochter aus Tonga, eine von jenen polynesischen Frauen, die den schönsten Europäerinnen aus dem Süden gleichen.
Ich habe nie ein weibliches Wesen gesehen, das mehr einer königlichen Prinzessin geglichen hätte. Unwillkürlich verbeuge ich mich sehr tief. Auch der alte Tui begegnet ihr mit Respekt, obwohl sie doch nur ein Weib ist und Weiber auf Fidschi nicht zählen. Aber um das Haupt der Prinzessin Andi schwebt die „Mana“, das ungeheuere Prestige des alten und heiligen Häuptlingshauses, aus dem sie stammt, dieser Familie der Inselkönige von Mbau, die seit dem Urbeginn der Zeiten da war. Auch ist die Prinzessin Andi reich. Sie hat das beste Kokosnussland, mehr als 350 Acres Pflanzungen. Der Mann, den sie geheiratet hätte, wäre auf weichen Matten dick und fett geworden. Aber sie hat niemals geheiratet.
„Seien Sie willkommen,“ sagt sie zu mir. „Wohnen Sie in unserem Gästehaus? Wir wollen Ihnen ein Fest geben. Es ist spät. Wären Sie früher gekommen, dann hätten wir viele Blumenkränze gewunden — —“
Ich gebe ihr den kleinen automatischen Fächer, und eine Minute lang spielt sie damit, wie ein erfreutes Kind. Dann gibt sie das Ding einer Dienerin zu halten, die vor ihr niederhockt, um es zu empfangen — —
Das Gästehaus, in dem ich schlafen soll, ist ein ganz gewaltiges Gebäude, gross und hoch und leer wie eine Ballonhalle. Es liegt auf einem künstlich erhöhten Hügel über dem grossen und sauberen Dorfplatz, der mit grünem Rasen bedeckt ist, wie der Kirchenplatz eines englischen Dorfes, und der ebenso zum Krikketspielen verwendet wird. Dem Gästehaus gegenüber steht die Kirche, scheusslich anzusehen, ganz Holz, Ecken und Wellblech. Irgendwo auf einem Hügel ist das Haus des wesleyanischen Missionars. Er ist der einzige Weisse, der auf Mbau wohnen darf, denn wenn auch die Europäer und die asiatischen Plantagenkulis auf allen anderen Inseln von Fidschi noch so zahlreich werden, die kleine königliche Insel Mbau hat man den alten Häuptlingsfamilien vorbehalten und zur Pflege der heimischen Tradition bestimmt. Mbau ist das Versailles, nein, das Potsdam von Fidschi. In diesen schönen luftigen Häusern in den kleinen Gärten dürfen nur Häuptlinge wohnen und ihre Frauen und Diener. Keine Kokosnuss darf auf dieser Insel wachsen, keine Brotfrucht. Was die grossen Herren brauchen, bringt man von den anderen Inseln: hier wird nicht gesät noch geerntet.
Es ist die Stunde des Sonnenunterganges, und das Meer um Mbau wird ganz rot und golden. „Rührei mit Paprika“, sagt der Apotheker Brown missbilligend und geht ins Innere des Gästehauses einen Whisky trinken, weil diese Stunde ohne Whisky sehr ungesund ist.
Ich sitze auf den monumentalen Stufen von schwarzem Basalt, die zu dem Gästehaus emporführen, und verbringe diese Stunde des Sonnenunterganges damit, dass ich den nackten schwarzen und kraushaarigen Kindern der Insel beibringe, wie man auf einer Mundharmonika den Radetzkymarsch bläst. Ich blase ihnen gerade den Radetzkymarsch vor, weil ich ihn mit grosser Bestimmtheit von den vielen anderen Melodien unterscheiden kann, die mein so unmusikalisches Gedächtnis nicht so gut kennt, aber auch, weil in diese feudale Cidevant-Atmosphäre der Insel Mbau kein anderes Lied gut passt, das ich blasen könnte.
Diese vielen Mundharmonikas, die ich mitgebracht habe, machen mich zum geliebtesten Onkel aller kleinen Negerlein auf der Häuptlingsinsel Mbau. Zwanzig, dreissig Stück kauern auf den Stufen, die zu dem Gästehaus führen, oder kriechen auf allen vieren über die Böschung des kleinen Hügels, der das hohe Haus über den schönen sauberen Grasplatz erhebt. Sie halten die Maultrommeln an die Zähne, als wollten sie sie abnagen; ich kann nicht umhin, an die Grossväter dieser munteren Knaben zu denken, die Menschenknochen benagten.
Ich habe leider, das stellt sich heraus, nicht genug Mundharmonikas für alle nackten kleinen Fidschibuben von Mbau mitgebracht. Einige von den Zurückgesetzten kann ich mit Schokolade trösten, aber ein achtjähriger Häuptlingssohn bleibt unversöhnlich und schneidet wilde Gesichter und ruft mir auf Fidschi ein Wort des Grolls zu, das ich nicht verstehe. Mehrere von den älteren Knaben haben in der Missionsschule Englisch gelernt, und ich frage einen von ihnen, was ihr Kamerad mir da zuschreit, mir, der ich ihm keine Mundharmonika mitgebracht habe.
Der Gefragte grinst:
„Er sagt, Sir: Ich fresse deine Augen, Sir!“
Wir verständigen uns zur Not sehr gut auf Englisch, aber es ist viel lustiger, wenn ich mein Notizbuch ziehe und in der Fidschisprache zu reden versuche. In dem Notizbuch steht: „jo“ heisst „ja“; „nein“ heisst „sengai“; „danke schön“ heisst „vinaka.“ Und „tou veitotaki“ heisst „wir wollen gute Freunde sein“.
Ich sage immerzu: „tou veitotaki“ und blase dann den Radetzkymarsch, annähernd. Eine Fidschimama, noch schlank wie ein Mädchen, mit einer Hybiscusblüte in dem halblangen gewellten Haar, das wie eine Bürste vom Kopf wegsteht, kommt mit einem guten Lächeln und setzt das nackte Baby, das sie auf ihrem Rükken getragen hat, auf meinen Schoss. Da mich die warme und samtene Haut des Kindes streift, geht durch mich ein merkwürdiges elektrisches Rieseln, ganz anders als jenes Gefühl, das die Berührung eines weissen Säuglings gibt.
Jetzt ist es völlig Nacht, auf einmal. Die Moskitos werden im Freien zu lästig. Ich gehe in das Innere des Hauses und esse etwas, aus meinen eigenen Vorräten, denn ich bin unangemeldet gekommen und zu spät, als dass man noch ein Schwein hätte schlachten und mit Brotfrucht und Taroknollen in der Kochgrube backen können.
Die Nacht ist schwül, aber die prachtvolle hohe Halle des Gästehauses hat poröse Wände, und vier grosse Türen, in jeder Himmelsrichtung offen, lassen die köstliche Brise durch das Gebäude streichen. Das steile Dach ruht auf tausendfach umwundenen und geschmückten Pfeilern; die Wände sind mit Matten bekleidet, von einem Geflecht wie Panamahüte, mit feinen schwarzen Mäandern und geometrischen Ornamenten. In diesem grossen, grossen Saal steht nur ein langer Tisch, auf den ich meine Geschenke gehäuft habe, die grellbunten Stoffe, Tabak und Flaschen billigen Parfüms. Ich sitze alla turca auf den Matten, an meine Reisetasche angelehnt. Draussen in der Dunkelheit taucht manchmal ein Licht auf; ein Eingeborener bringt eine Windlampe und stellt sie vor mich hin auf die Matte. Dann kommen sie, truppweise, die Knaben und die jungen Mädchen von Mbau. Der alte Häuptling, der Tui, befehligt sie wie ein Schulmeister. Jetzt hocken sie alle nieder, auf einer Seite die Knaben, in ordentlichen Reihen, vier Bub tief, auf der anderen die Mädchen, die ihre losen, bunten Kattunkittel tragen und Blumenkränze. Einige von ihnen, aber nur wenige, haben diese absonderlichen semmelblonden oder fuchsroten Haare, die sie hervorbringen, indem sie ihren Kopf mit Lehm einschmieren oder mit Kalklauge bearbeiten.
Читать дальше