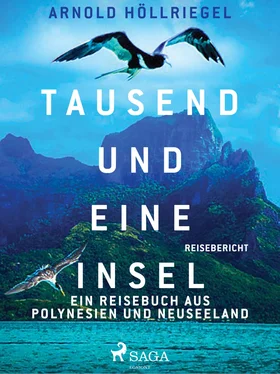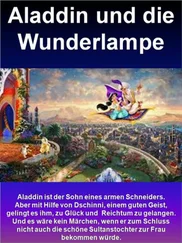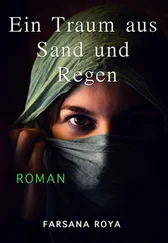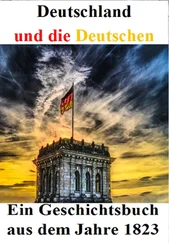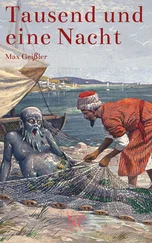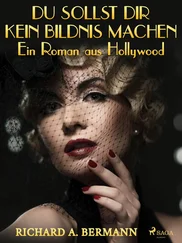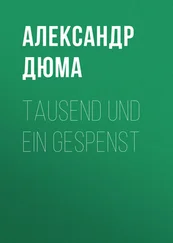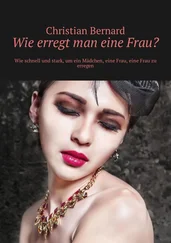Im Hintergrund sitzen die Männer von Mbau, nicht viele, denn Ratu Pope hat ein stattliches Gefolge mit sich genommen. Es sind nur einige Jünglinge zurückgeblieben, herrlich gebaute Athleten, von deren schwarzen geölten Schenkeln das Lampenlicht reflektiert wird wie von lackierten Schaftstiefeln. Ihre Haare, die ganz weich sind und wunderbar gepflegt, stehen gewaltig über den schönen breiten Stirnen zu Berge. Alle anwesenden Kanaken tragen den Sulu genannten Lendenschurz, obgleich Ratu Bola mir gleich versichert hat, dass er auch Hosen besitzt, „ganz genau ebenso wie weisser Mann, wett’ dein Leben“. Ratu Bola, ein rüstiger Herr von Sechzig, ist ausser dem alten Tui Savura der einzige Häuptling, der augenblicklich auf Mbau ist, die anderen haben alle die Heerfahrt ihres geborenen Lehensherren mitgemacht, Ratu Popes.
Ratu Bola spricht ein geläufiges, aber persönliches Englisch, das er am Strand von Suva aufgelesen hat, mit drolligen amerikanischen Slang-Ausdrücken. Er ist ein stattlicher Mann und ein Aristokrat, aber ich kann nicht verhehlen, dass er zu oft ein Glas Whisky von mir fordert. Ich habe die Absicht, den Rest des Whiskys als Geschenk zu hinterlassen, nicht aber, diese Kannibalenenkel sehr betrunken zu machen, solange ich da bin. Nur der äusserste Takt hilft aus dieser Klemme. Aber der Ratu ist nicht unverschämt, nur gierig wie ein Kind.
Immerhin muss ich das Gesprächsthema wechseln. Ach, reden wir doch nicht fortwährend von Whisky und solchen Sachen. „Werden diese jungen Leute singen?“ frage ich.
„Bet y’r life,“ sagt der Ratu, „wett’ dein Leben, sie werden singen wie ein Schuss! Grosse ‚Meke‘, für dich. Trinkt man viel Whisky in deinem Land?“
Die „Meke“, mit der man heute abend den Gast der Insel Mbau unterhält, ist nicht sehr gross und nicht sehr zeremoniell, vielleicht wegen der allgemeinen Unwürdigkeit des Gastes, der kaum ein sehr grosser Häuptling ist, vielleicht, weil er so spät kam und grosse Vorbereitungen nicht möglich waren, vielleicht auch, weil man nicht vorher gewusst hat, wie viele Geschenke er mitbrachte. Vor einer wirklich grossen Meke legen Männer und Frauen die festlichen Gewänder aus Tapastoff an oder die Tanzröcke aus breiten und langen Blättern, die vom Gürtel bis zum Knie herabhängen, giftgrün oder kirschrot gefärbt. Heute haben sie auch nicht die kostbaren Halsbänder aus Walfischzähnen angelegt, ja, sie haben ihre Gesichter kaum ordentlich mit Russ gepudert, so wenig grossartig geht es heute zu. Nur gesungen wird und ein wenig dramatischer Tanz geübt. Zwei Chöre, einer von Männern und Knaben, einer von Frauen, singen, im Halbdunkel des ungeheueren Saales hockend, diese Lieder, die ich nicht verstehe, die mir aber ganz wunderbar scheinen: nichts Negerisches oder Wildes ist in diesem süssesten, holdesten Zusammenklingen der vielstimmigen Vokalmusik. Von den beiden Häuptlingen scheint der alte Tui als eine Art Kapellmeister zu wirken, er dirigiert mit energischen Winken oder kurzen und scharfen Befehlen. Ratu Bola sitzt neben mir auf der Matte und dolmetscht mir, rücksichtslos laut, was zu dolmetschen er gut findet. Das erste Lied, sagt er, ist ein patriotisches Lied: es ist herrlich, singen sie, in Fidschi zu leben, die Leute von Fidschi sind sehr gross und stark — —
Ratu Bola hält in seiner Übersetzung auf einmal inne, mit einem schelmischen Ausdruck in seinem alten Lebemannsgesicht. Sagt dieses Lied etwa, wie stark die Leute von Fidschi sind? So stark vielleicht, dass sie die Augen aller ihrer Feinde essen können? Ich weiss, sie tun es nicht mehr; aber ich weiss auch, in was für einem Haus ich hier sitze. Der greise Tui Savura muss noch dabei gewesen sein, als hier, auf dieser gleichen Stelle, der Tempel des dreiköpfigen Gottes von Mbau stand, ein Tempel, in dem man das „Lange Schwein“ geschlachtet hat, das zweibeinige, dem Gotte zu Ehren — —
Aber jetzt singen die Leute von Mbau ein anderes Lied, eines, das ein lokaler Barde heute abend eigens gedichtet hat, um mich zu begrüssen, eine epische Ballade, deren Held ich bin, der Fremde mit der Brille, der in dem Boot des Apothekers Brown aus Suva gekommen ist. Er ist in seinem Land ein Häuptling oder vielleicht ein Missionar, und er hat Geschenke mitgebracht, viele, viele — —
Dann kommt ein ganz anderes Lied, ein Lied aus dem grossen Krieg, der auf die Männer von Fidschi so einen Eindruck gemacht hat. Die Engländer sind sehr tapfer, tapfer, und den Kaiser eines Stammes, der: „die Deutschen“ heisst, haben sie gefangengenommen — —
Dann kommt wieder ein sanftes und liebliches Lied der Frauen, nicht ein Lied von Fidschi, sondern das schöne samoanische Lied, das man auf allen Inseln der Südsee kennt: „Tofa mai feleni.“ „Lebe wohl, mein Freund.“ Es ist ein sentimentales Lied vom Abschiednehmen, und es hat einen englischen Refrain:
„Oh, I never will forget you — —“
Sie singen das immer wieder, immer wieder, und dann andere Lieder. Lieder von Fidschi und sanftere von Samoa, von Tonga.
Dazwischen zeigen einmal die kleinen dunkeläugigen Buben, was sie in der Missionsschule gelernt haben. „Tipperary!“ jubeln sie, den scharfen Takt mit klatschenden Händen markierend. „Es ist ein langer, langer Weg nach Tipperary — —“
Dann wieder ziehen sich alle die Chöre in den Hintergrund zurück; ich sehe sie nur rhythmisch sich biegen, während sie, auf ihren Schenkeln sitzend, die Melodie des Tanzes patschen. Vorn aber, im Lichtkegel der Windlampe, haben drei wunderschöne junonische Mädchen sich niedergelassen, ganz bekränzt mit schwer duftenden Blüten. Sie tanzen, sitzend, einen Tanz, der das Lied des Chorus illustriert. Sie bewegen nur, in massvoll strenger Disziplin, ein wenig den Oberleib und die nackten Zehen; die eigentliche mimische Sprache des Tanzes reden ihre schönen bronzenen Arme und ihre adeligen Hände, deren Bewegung die Essenz des Liedes verkörpert und die einfache Handlung der Ballade dem fremden, fremden Gast fast völlig verständlich macht.
Die ganze Nacht, die ganze Nacht dauern die Lieder. Die Sänger sitzen im Hintergrund der Halle; in der Mitte hockt ein würdevoller Funktionär vor der grossen kuriosen Holzschale, in der man unter vielen Zeremonien Kawa gebraut hat, den Rauschtrank Polynesiens, der keinen Rausch gibt, nur eine unbestimmte lässige Müdigkeit der Beine. Die Yangona-Wurzel, aus der man diese trübe laue Jauche macht, wird auf Mbau nicht mehr von den Frauen vorgekaut, wenigstens nicht vor den Gästen. Sie machen das Mehl der zerriebenen Wurzel mit lauem Wasser an und seihen es durch ein Tuch. Dann taucht ein Mann in das hölzerne Becken eine halbe Kokosschale, in deren Innerem längst eine besondere Patina entstanden ist, und bringt sie dem Ratu.
Ratu Bola hat eben versucht, mir nicht ohne Anzüglichkeit zu erklären, dass Kawa sehr gut ist, aber Whisky auch. Ich verstehe nicht und höre hingerissen dem leisen Gesang zu. Der Ratu winkt resigniert dem Mann mit der Kawa, der bringt die Kokosnussschale und hockt demütig vor ihm nieder, denn niemand steht vor einem Häuptling. Nun muss auch ich kosten. Ich tue es, das gebührende Zeremoniell sorgsam beachtend. Erst ein Schluck von dem lauwarmen Gesöff, das zunächst wie Chloroform mit Spucke schmeckt, dann aber doch den Durst auf eine ganz geheimnisvolle Weise auszulöschen scheint und im Mund eine eigentümliche herbe Frische hinterlässt. Man muss, bevor man die Schale nimmt und trinkt, dreimal in die Hände klatschen und rufen: „Bola!“ Bola heisst „Prosit“, und den Ratu Bola könnte man so übersetzen: Prinz Prosit.
Nachdem man getrunken hat, fängt man ein wenig zu grunzen an, und man massiert sich mit beiden Händen die Speiseröhre, durch die der Nektar herabrieselt. Oh, heuchelt man mimisch, das hat aber geschmeckt!
„Whisky ist auch sehr gut!“ bemerkt der Prinz Prosit, ganz beiläufig, nachdem wir die Kawa getrunken haben.
Читать дальше