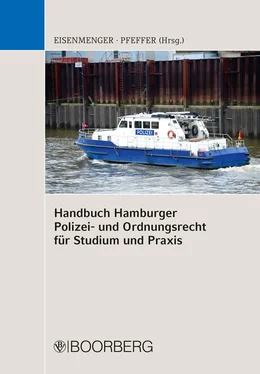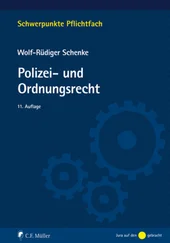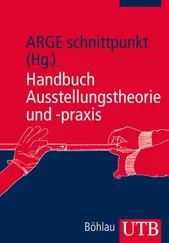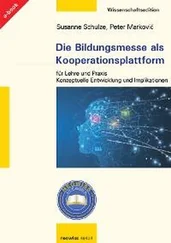1. Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen
2. Staatsstrukturprinzipien
3. Grundrechtliche Anforderungen
B. Befugnisse nach dem SOG
I. Grundlagen
1. Gefahrenabwehrmaßnahmen im Überblick und Struktur der Rechtmäßigkeitsprüfung
2. Generalklausel, § 3 Abs. 1 SOG
3. Verantwortlichkeit, §§ 8–10 SOG
4. Ermessen, insbesondere Verhältnismäßigkeit
II. Personenbezogene Standardmaßnahmen
1. Vorladung, § 11 SOG
2. Meldeauflage, § 11 a SOG
3. Feststellung der Personalien, § 12 SOG
4. Platzverweisung, § 12 a SOG
5. Betretungs-, Aufenthalts-, Kontakt- und Näherungsverbot, § 12 b SOG
6. Polizeiliche Begleitung, § 12 c SOG
7. Gewahrsam von Personen, § 13 SOG
8. Durchsuchung und Untersuchung von Personen, § 15 SOG
III. Objektbezogene Standardmaßnahmen
1. Sicherstellung von Sachen, § 14 SOG
2. Durchsuchen von Sachen, § 15 a SOG
3. Betreten und Durchsuchen von Wohnungen, §§ 16, 16 a SOG
IV. Durchsetzung
1. Anwendbarkeit der Durchsetzungsbefugnisse
2. Ersatzvornahme im gestreckten Verfahren
3. Unmittelbarer Zwang im gestreckten Verfahren
4. Unmittelbare Ausführung der Ersatzvornahme und des unmittelbaren Zwangs
V. Kosten- und Entschädigungsrecht
1. Vorbemerkung: Sekundärebene/gerechter Lastenausgleich im Überblick
2. Kostenansprüche der Verwaltung gegen den Bürger
3. Störer-Innenausgleich
4. Kostentragung durch den Begünstigten
5. Entschädigungsansprüche des Bürgers gegen den Staat
C. Befugnisse nach dem PolDVG
I. Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und allgemeine Grundsätze
1. Anwendungsbereich, § 1 PolDVG
2. Begriffsbestimmungen, § 2 PolDVG
3. Allgemeine Grundsätze, §§ 3–9 PolDVG
II. Allgemeine und besondere Befugnisse zur Datenverarbeitung
1. Vorbemerkung
2. Allgemeine Befugnisse, §§ 10–15 PolDVG
3. Besondere Befugnisse, §§ 16–33 PolDVG
III. Weitere Datenverarbeitung
1. Vorbemerkung
2. Allgemeine Grundsätze, §§ 34, 35 PolDVG
3. Weitere Datenverarbeitung, § 36 PolDVG (§ 16 PolDVG a. F.)
4. Verarbeitung zu archivarischen, wissenschaftlichen, historischen und statistischen Zwecken sowie zur Aus- und Fortbildung, § 37 PolDVG (§ 17 PolDVG a. F.)
5. Datenübermittlung, §§ 38–47 PolDVG
6. Datenabgleich, § 48 PolDVG (§ 22 PolDVG a. F.)
7. Automatisierte Anwendung zur Datenanalyse, § 49 PolDVG
8. Rasterfahndung, § 50 PolDVG (§ 23 PolDVG a. F.)
9. Zuverlässigkeitsüberprüfung, § 51 PolDVG (§ 21 Abs. 1 Nr. 5 PolDVG a. F.)
D. Befugnisse nach dem HafenSG
I. Grundlagen
II. Maßnahmen
1. Allgemeine Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, § 2 HafenSG
2. Vorschriften für die grenzpolizeiliche Aufgabenwahrnehmung, § 3 HafenSG
3. Vorschriften zur Überprüfung der Sicherheit im Zusammenhang mit der Beförderung gefährlicher Güter, § 4 HafenSG
Sachregister
A. Grundlagen des Hamburger Polizei- und Ordnungsrechts
I. Gegenstände des Hamburger Polizei- und Ordnungsrechts
Sven Eisenmenger
1. Polizei- und Ordnungsrecht als Teil des Öffentlichen Rechts
1
Befasst man sich in der Ausbildung, im Studium oder in der Praxis mit dem Hamburger Polizei- und Ordnungsrecht, so gilt es zunächst, das Gebiet einzugrenzen und abzugrenzen. Der Grund hierfür liegt nicht nur darin, eine Arbeitsgrundlage für die Kommunikation zu schaffen, sondern auch darin, dass sich aus der Bestimmung des Gebietes die Inhalte eines Handbuchs zum Hamburger Polizei- und Ordnungsrecht ableiten.
2
Die Konkretisierung erfolgt vom Allgemeinen zum Besonderen. Insofern ist zunächst an der Dreiteilung zwischen Öffentlichem Recht, Privatrecht und Strafrecht anzusetzen. Das Öffentliche Rechtfokussiert auf alle Rechtsbeziehungen im Verhältnis Staat-Privat oder Staat-Staat, wobei dies auf staatlicher Seite Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung sowie auf privater Seite natürliche Personen oder Personengesellschaften und juristische Personen sein können. 1In der klassischen polizeilichen Situation geht es hierbei z. B. um polizeiliche Platzverweise gegenüber Bürgern (§ 12 a SOG), um Sicherstellungen von Sachen (§ 14 SOG) bis hin zu Ingewahrsamnahmen (§ 13 SOG). Abzugrenzen vom Öffentlichen Recht ist das Privatrecht, bei dem es um das gesamte Recht im Verhältnis Privat-Privat geht, also z. B. um Kaufrecht, Mietrecht, Werkvertragsrecht, Gesellschaftsrecht etc. Soweit der Staat am Wirtschaftsleben als Nachfrager (z. B. Käufer von Sachmitteln) oder ggf. sogar als unternehmerischer Anbieter teilnimmt (z. B. kommunale Stadtwerke), finden sowohl öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche Regelungen Anwendung. 2Das Strafrechtwiederum behandelt – wie das Öffentliche Recht – Rechtsfragen im Verhältnis Staat-Privat, hier aber speziell mit dem Ziel der Sanktionierung des Verhaltens von Privaten insbesondere mit Geld- und Freiheitsstrafen, z. B. bei Verstößen gegen das Strafgesetzbuch. 3An der Schnittstelle von Öffentlichem Recht und Strafrecht liegt das Recht der Ordnungswidrigkeiten, im Rahmen dessen Private ggf. ein Bußgeld entrichten müssen.
3
Das Polizeirechtist Teil des Öffentlichen Rechts. Es beschreibt das Handeln der Polizei in den Fällen der Gefahrenabwehr (präventives Handeln). Ziel ist der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie § 3 Abs. 1 SOG belegt. Die Polizei ist zur Gefahrenabwehr in allen unaufschiebbaren Fällen befugt (§ 3 Abs. 2 Satz 1 lit. a SOG). Zum Hamburger Polizeirecht gehört mithin das Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (SOG), das Gesetz über die Datenverarbeitung der Polizei (PolDVG) und das Hafensicherheitsgesetz (HafenSG). Dabei handelt es sich um die wichtigsten Rechtsgrundlagen auf Hamburger Landesebene, die nachfolgend kommentiert werden. Selbstverständlich kommen weitere Rechtsgrundlagen hinzu, wie z. B. die vom Senat erlassene Verordnung über das Verbot des Führens von Waffen und gefährlichen Gegenständen. Daneben existiert eine Vielzahl von Befugnissen nach Bundesgesetzen (z. B. im Versammlungsgesetz) oder in Bundesverordnungen (z. B. in der Straßenverkehrsordnung), die aber nicht Gegenstand des spezifischen Hamburger Polizeirechts im Sinne des Handbuchs sind. Soweit die Polizei im Übrigen repressiv handelt, also Maßnahmen zur Strafverfolgung nach der Strafprozessordnung ergreift, handelt es sich nicht um Polizeirecht im beschriebenen – präventiven – Sinn, sondern um Strafverfahrensrecht in repressiver Hinsicht. Das Strafrecht ist nicht Gegenstand des Handbuchs, zumal es sich auch nicht um spezifisches Hamburger Recht handelt. Hier kann der Leser problemlos auf bestehende Literatur zurückgreifen. 4
4
Das Ordnungsrechtist auch Teil des Öffentlichen Rechts. Es beschreibt ebenso alles Handeln in Fällen der Gefahrenabwehr (präventives Handeln). Ziel ist auch hier der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie § 3 Abs. 1 SOG belegt. Der Unterschied liegt zum polizeilichen Handeln darin, dass hier nicht die Polizei, sondern die sonstigen Verwaltungsbehörden zur Gefahrenabwehr befugt sind, also gem. § 4 Abs. 1 des Gesetzes über die Verwaltungsbehörden insbesondere die Bezirksämter und Fachbehörden. Das SOG grenzt dies insoweit ein, als dass die Verwaltungsbehörden Maßnahmen zur Gefahrenabwehr „im Rahmen ihres Geschäftsbereichs“ treffen können (§ 3 Abs. 1 SOG). Zum Ordnungsrecht, das sich im hier verstandenen Sinn auf alles Recht der Verwaltungsbehörden zum präventiven Schutz der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung bezieht, gehören zuvörderst das SOG und auch hier eine Vielzahl weiterer landesrechtlicher Vorschriften (man denke nur an das Landesbaurecht). Darüber hinaus existiert eine erhebliche Anzahl von Befugnisgrundlagen auf Bundesebene, wie z. B. im Wirtschaftsüberwachungsrecht mit der Gewerbeordnung. 5
Читать дальше