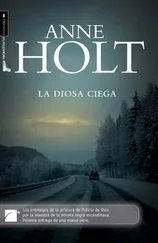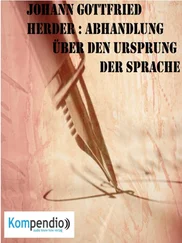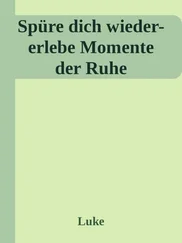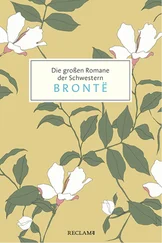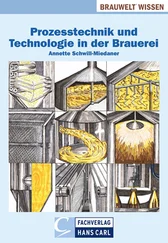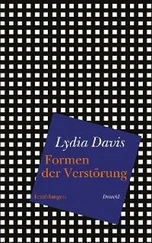La qualité attribuée à la brièveté relève d’une bipolarisation entre le positif et le négatif. Les auteurs légitiment la supériorité de la parole brève et son imaginaire positif par des arguments tels qu’une plus grande rapidité de dénotation : la formule brève ou le mot court permettraient de réaliser cet idéal d’univocité maximale, effet qui serait d’autant mieux réalisé qu’on a affaire à une quantité réduite de signifiants. Les exemples illustrent le jugement épi- et métalinguistique d’une progression qualitative, en urbanité, en esthétique, en moyens matériels et humains par une économie de signes. La raison en serait-elle à chercher dans le cours du monde et la lutte contre l’infobésité contemporaine, comme le suggère Siever (2011 : 13) ?
Non : les raisons invoquées sont difficiles à justifier objectivement, et cet imaginaire découle d’une idéologie positiviste qui fusionne les mots avec les choses, découlant d’une vision instrumentale de la langue. C’est ainsi que dans l’imaginaire langagier franco-allemand, la brièveté est polie, belle, et efficace.
Armisen-Marchetti, Mireille, 1996. « Des mots et des choses : quelques remarques sur le style du moraliste Sénèque ». In : Vita Latina , 141, 5–13. Doi : https ://doi.org/10.3406/vita.1996.940
Bachelard, Gaston, 1972. La formation de l’esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective . Paris : Librairie philosophique Vrin.
Balnat, Vincent, 2013. « Kurzvokal, Kurzwort, Kurzsatz, Kurztexte : Kürze in der Sprachbeschreibung des Deutschen ». In : Zeitschrift für Literatur und Linguistik (LiLi), 43 / 170, 82–94.
Behr, Irmtraud, 1995. « Von der Verselbständigung der sprachlichen Elemente beim wiederaufnehmenden Reden ». In : Faucher, Eugène / Métrich, René / Vuillaume, Marcel (éds). Signans und Signatum. Auf dem Weg zu einer semantischen Grammatik. Festschrift für Paul Valentin zum 60. Geburtstag . Tübingen : Narr, 383–394.
Frei, Henri, 1929. La grammaire des fautes. Introduction à la linguistique fonctionnelle, assimilation et différenciation, brièveté et invariabilité, expressivité . Réédition par les Presses Universitaires de Rennes, 2011.
Fritz, Gerd, 2016. « Kurze wissenschaftliche Texte. Potenziale und Probleme ». In : Fritz, Gerd (éd.). Beiträge zur Texttheorie und Diskursanalyse. Gießener Elektronische Bibliothek , 77–98. URL : http ://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2016/1204, dernière consultation le 17 octobre 2018.
Grice, Paul, 1979. « Logique et Conversation ». In : Communications , 30, 57–72.
Houdebine-Gravaud, Anne-Marie, 2002. « L’imaginaire linguistique : un niveau d’analyse et un point de vue théorique ». In : Houdebine-Gravaud, Anne-Marie (éd.). L’imaginaire linguistique . Paris : L’Harmattan, 9–21.
Macheiner, Judith, 1991. Grammatisches Variété oder die Kunst und das Vergnügen, deutsche Sätze zu bilden . Francfort sur le Main : Eichborn.
Martinet, Alain, 1961. Éléments de linguistique générale . Paris : Armand Colin.
Montandon, Alain, 1992. Les formes brèves . Paris : Hachette.
Münch, Richard, 2007. Die akademische Elite. Zur sozialen Konstruktion wissenschaftlicher Exzellenz . Francfort sur le Main : Suhrkamp.
Paul, Hermann, 1880. Prinzipien der Sprachgeschichte. 10te Ausgabe . Tübingen : Niemeyer, 1995.
Ridell, Karin, 2016. « Une langue administrative claire et compréhensible : un droit politique et démocratique ? L’histoire idéologique de la klarsprak en Suède ». In : Potriquet, Guislain / Huck, Dominique / Truchot, Claude (éds), “Droits linguistiques” et “droit à la langue”. Identification d’un objet d’étude et construction d’une approche . Limoges : Lambert-Lucas, 153–166.
Salmandjee-Lecomte, Yasmina, 2008. Je me mets à l’Internet . Paris : First Interactive.
Schmucki, Fabio, 2017. « Kurze Sätze, gute Texte. Satzlängen und ihre Wirkung ». In : https ://blog.supertext.ch/2017/04/kurze-satze-gute-texte-satzlangen-und-ihre-wirkung/, dernière consultation le 7 mai 2018.
Schneider-Mizony, Odile, 2001. « Lichtenbergs Aphorismen als Ein-Satz-Texte ». In : Parisot, Richard (éd.). Les Aphorismes de Lichtenberg . Besançon : Presses Universitaires Franc-Comtoises, 29–42.
Siever, Torsten, 2011. Texte i.d. Enge. Sprachökonomische Reduktion in stark raumbegrenzten Textsorten . Francfort sur le Main : Peter Lang.
Sowinski, Bernhard, 1972. Deutsche Stilistik. Beobachtungen zur Sprachverwendung und Sprachgestaltung im Deutschen . Francfort sur le Main : Fischer Taschenbuch.
Winther, Per / Lothe, Jakob / Skei, Hans, 2004. The Art of Brevity. Excursions in Short Fiction Theory and Analysis . Columbia [SC] : University of South Carolina Press.
Die lange Geschichte der kurzen Formen
Frank Liedtke
Das Ideal eines Satzes im Allgemeinen wurde lange Zeit darin gesehen, dass er aus zwei Gliedern besteht – Subjekt und Prädikat – und dazu dient, einen möglichst zutreffenden Gedanken auszudrücken. Diese Bestimmung seiner Form wie auch seiner Funktion findet sich bei Aristoteles in der Schrift Peri hermeneias . In diesem frühen sprach- und zeichentheoretischen Entwurf geht es um die gegenseitige Zuordnung der Dinge sowie der Gedanken und der Laute eines Sprechenden im Behauptungssatz:
Die Gedanken in der Seele eines Sprechenden sind – als Abbilder der Dinge – weder wahr noch falsch, und die Laute, die ihnen zeichenhaft entsprechen, sind es in Gestalt isolierter Nomen oder Verben ebenfalls nicht. Erst wenn die Gedanken in der Seele miteinander verbunden werden, und entsprechend die Nomen und Verben in der Rede, kann Wahrheit oder Falschheit zugesprochen werden ( Peri hermeneias , 1. Kap., 16a).
Seine Funktion kann der Behauptungssatz nur erfüllen, wenn er mindestens zweigliedrig ist und so die Verbindung der Gedanken anzeigen kann – zutreffend oder unzutreffend. Diese Grundauffassung der Zweigliedrigkeit wurde bis ins 19. Jahrhundert unhinterfragt übernommen. Kurze Formen sind demgegenüber durch das Fehlen eines der beiden Glieder ausgezeichnet, entweder des Subjekts oder des Prädikats.
Ob und inwiefern auch diese Formen die Funktion des Gedankenausdrucks erfüllen können, war Gegenstand einer Ende des 19. Jh. einsetzenden Debatte über die Eingliedrigkeit von Sätzen, die sich weit ins 20. Jh. hineinzog. In ihrem Verlauf etablierte sich allmählich die Auffassung, dass eingliedrige Sätze nicht unvollständig oder defizitär sind, sondern gleichrangig gegenüber zweigliedrigen Sätzen zu behandeln sind. Die Untersuchungen von Behr / Quintin (1996) über verblose Sätze, von Schwabe et al. (2003) zu ‚Omitted Structures‘ sowie von Redder et al. (2012) über unpersönliche Konstruktionen bilden rezente Beispiele für diesen Perspektivenwechsel.
Im Folgenden soll die Debatte um die Eingliedrigkeit von Sätzen in wissenschaftshistorischer Absicht nachgezeichnet werden, da hier schon wesentliche und sehr moderne Argumente für kurze Formen, verbunden mit Überlegungen zur Funktion von Sätzen, vorgebracht wurden. Grundsätzlich – soviel sei schon gesagt – geht es in dieser und den nachfolgenden Debatten um die Frage, ob ein aus der Logik übernommenes Muster der Satzbildung verbindlich ist, was für die Zweigliedrigkeit spricht, oder ein sprachnahes Kriterium gilt, was die Eingliedrigkeit von Sätzen durchaus zulässt. Näheres dazu im folgenden Abschnitt.
Читать дальше