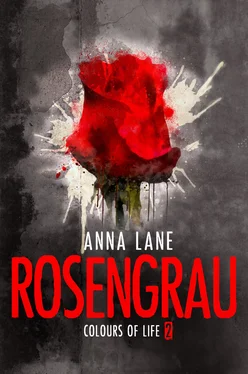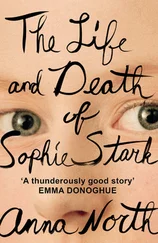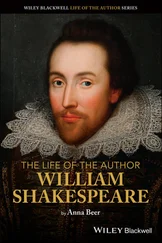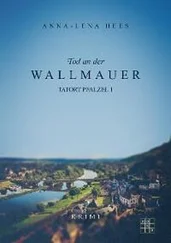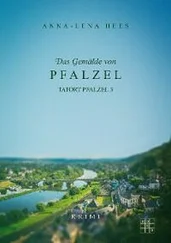»Die ganze Langeweile bringt mich noch um«, hat er kopfschüttelnd gesagt, nachdem Carter ihm seine blau-blonde Mähne abrasiert hat.
»Glaub mir, noch viel eher tötet dich etwas anderes«, hat Carter geantwortet, und Neptune hat den Mund gehalten. Ich glaube, mit jedem Haar, das zu Boden gefallen ist, zerbrach sein Herz ein wenig mehr. Neptune ist noch nie in seinem Leben normal gewesen. Und jetzt, ohne Vorwarnung, hatte er keine andere Wahl.
Tyler hat sich nicht geändert, aber so wie Neptune von der Bedeutungslosigkeit zerfressen wird, hat die Wut von Tyler Besitz ergriffen. Hin und wieder, wenn ich nachts umherwandle, komme ich am Sportraum vorbei. Das Licht brennt, und ich schleiche mich auf nackten Füßen an, um durch den offenen Türspalt zu blicken. Meistens hämmert Tyler auf irgendetwas ein – einen Sandsack, eine Matte. Eine Weile sehe ich ihm dann zu, weil ich ihn heimlich um seine Wut beneide. Er kann sie rauslassen, kann sich die Fäuste wund schlagen und dann völlig außer Atem sein.
Aber ich … ich bin nur schlaflos. Ich irre umher wie ein Geist, der kein Zuhause hat, und wenn ich ehrlich bin, dann könnte ich selbst dort keine Ruhe finden. Ich suche etwas, das nicht zu finden ist, und zähle still die Stunden, die ich rastlos und allein im Dunkel verbringe. Zu oft bin ich einsam. Die Nacht ist zu meinem besten Freund geworden.
»Um sieben gibt es Abendessen. Vergiss das nicht«, erinnert mich Neptune, als wir in unserem Stockwerk angekommen sind.
Ich öffne die Tür zu meinem Zimmer und nicke. »Bist du heute mit Kochen dran?«
»Wie immer.« Neptune verdreht die Augen.
»Dann verzichte ich.« Ich versuche, ein kleines Lächeln auf meine Lippen zu zwingen, doch es gelingt mir nicht wirklich. Ich habe schon vor einigen Wochen aufgehört, Neptune vormachen zu wollen, dass ich okay bin. Er akzeptiert es. Genauso, wie ich seine Angst vor dem Nichts-Sein als das hinnehme, was sie ist.
»Es gibt aber …«
»Nudeln? Wer hätte das gedacht«, vervollständige ich seinen Satz. Dann schließe ich die Tür hinter mir und lasse mich dagegen sinken.
Von draußen höre ich: »Kohlehydrate und Fett, was willst du mehr?« Dann fällt Neptunes Tür mit einem Klicken zu.
»Was tun wir hier?«, flüstere ich und mache für einen kurzen Moment die Augen zu.
Fast hätte ich es nicht geschafft. Aber nicht die Anstalt hätte mich gekriegt oder Preston. Ob er wohl noch immer denkt, ich sei tot?
Nein, beinahe wäre ich durch die Hand eines Freundes gestorben.
Mein Rücken schmerzt, als die Erinnerung an den Schlag mich erschaudern lässt. Kurz vor dem Ablegen von Noahs Schiff wollte ich noch einen Blick in das alte Haus meiner Familie werfen. Einen letzten Augenblick für mich, den ich der Vergangenheit schenken würde, bevor meine Zukunft beginnen würde. In Freiheit. Mit Cam.
Aber dann … Mir wird der Hals eng, ich presse die Lider aufeinander. Instinktiv fliegen meine Hände zu meiner Kehle, während die Bilder auf mich einstürzen.
»Was tust du da?«, frage ich, ringe um Luft.
Daniel steht hinter mir. Der Lauf seiner Pistole gleitet beinahe liebevoll von meinem Kiefer zu meiner Schläfe. Angst breitet sich in meiner Brust aus wie ein Fegefeuer. Er lacht kurz auf, es klingt bitter. Der Wahnsinn hat ihn nun ganz zu sich genommen, aus einem Schock ist eine Manie geworden.
»Crys!«, brüllt jemand, ich glaube, es ist Cam, doch ich bin mir nicht sicher. Dan hat meine volle Aufmerksamkeit. Sein Mund ist nahe an meinem Ohr, er flüstert Worte, die ich nicht verstehe. Als wolle er mich umarmen, gleitet sein linker Arm langsam um meinen Körper herum, seine Fingernägel graben sich in meinen Hals.
»Lass los!«, knurre ich und versuche, mich zu befreien. Aber anstatt mich loszulassen, drängt er mich nur näher zum Abgrund. Ein paar Zentimeter, und ich bin tot. Zerschlagen auf den Felsen, die vom Meer zu spitzen Messern geschliffen wurden.
»Das ist das Ende.« Ich kann an seiner Stimme hören, dass er lächelt. Wieso tut er das? »Sag Lebewohl zu deinem Leben. Ich werde deines zerstören, wie du meines zerstört hast.«
»Wieso?« Ich drehe meinen Kopf zu ihm.
Grob reißt er mein Gesicht wieder nach vorne. Er weiß, dass ich ihn so nicht beeinflussen kann.
Dan presst die Worte hervor: »Du hast Zare getötet. Du hast ihr nicht geholfen. Du und Cameron … ihr habt sie umgebracht.« Ich will ihm ins Wort fallen, doch er lässt mich nicht. »Und jetzt … jetzt werde ich dich umbringen.«
Er schiebt mich noch näher an den Abgrund, dann tritt er einen Schritt zurück. Der Pistolenlauf ruht nun in meinem Rücken. Ich schließe die Augen, mache mich bereit zu sterben.
Cameron ist zu weit weg. Ich bin Daniel ausgeliefert.
Ehe ich ein weiteres Mal einatmen kann, zerreißt ein Schuss die Luft.
Cam hat mich gerettet. Und Daniel ist tot. So tot, wie er mich am Ende unserer Flucht sehen wollte. Ich fröstle. Cam …
Cam ist immer unterwegs, hat offensichtlich eine größere Aufgabe, und wir … Was tun wir hier?
Diese Frage stelle ich mir in letzter Zeit zu oft. In den drei Monaten, die wir bereits in Edinburgh sind, haben wir rein gar nichts getan.
Wir wohnen, wir schlafen, wir essen, wir langweilen uns, wir erledigen unsere kleinen Aufgaben. Wir leben einfach, aber ohne irgendetwas wirklich zu tun. Wir sind nur, ohne etwas zu schaffen. Ohne etwas zu erreichen. Und was Cam betrifft …
Seit wir hier angekommen sind, hat er mich nicht mehr so angesehen wie auf der Flucht. Er hat mich kein einziges Mal geküsst. Wie konnte ich auch denken, dass diese durch Angst erzwungenen Gefühle anhalten würden? Wie konnte ich denken, dass er jemanden wie mich will? Ich bin nicht klug. Ich bin nicht schön. Ich bin nicht mal mutig, sondern nur leichtsinnig, und am Ende muss ich immer gerettet werden. Selbst wenn ich die sein will, die jemand anderen rettet. Auf ganzer Linie verkorkst, so bin ich.
Ich schäle mich aus dem Handtuch und gehe unter die Dusche, der Dampf beschlägt die Fliesen des kleinen Badezimmers. Das ganze Zimmer ist so leer wie meine Seele. Keine Heimeligkeit. Kein Wohlbefinden. Kein Besitz. Nichts, das mir Freude bereitet. Als hätte man mein Inneres nach außen gestülpt, spiegelt die nachlässige Sterilität die Trostlosigkeit meiner Gedanken wider. Die Bettdecke ist nie aufgebettet und liegt meist zurückgeschlagen auf dem Doppelbett. Die hellbeige Tapete löst sich in den Zimmerecken schon leicht, und das dunkle Holz ist ausgeblichen.
Doch leider ist das hier kein Hotel, in dem ich nur übernachte, weil ich gerade auf einer Weltreise bin und hier als Zwischenstopp vor meiner Nordpol-Expedition halte. Hier leben wir. Hier sind wir frei, und auch wieder nicht. Man – die Mitglieder des Requiems – hat uns angewiesen, hauptsächlich im Fountains zu bleiben und die Hausarbeiten zu erledigen.
Ich komme mir vor, als wäre ich von einem Gefängnis in das nächste gesteckt worden, doch ich darf mich nicht beklagen. Hier geht es mir gut, das Requiem sorgt für uns. Um ehrlich zu sein, weiß ich noch immer nicht, wer hinter dem Requiem eigentlich steckt. Die einzigen Erwachsenen, die sich hier regelmäßig sehen lassen, sind Carter und Dr. Willem Sanders, der uns nach unserer Ankunft untersucht hat. Hin und wieder kann ich nachts beobachten, wie fremde Frauen und Männer in Carters Büro ein- und ausgehen. Und manchmal höre ich dann Dinge, die ich wahrscheinlich nicht hören sollte.
Denn hinter einem Mauervorsprung verborgen lausche ich den Gesprächen, wenn Carters Besuch das Büro verlässt. »Du solltest deine Leute besser kontrollieren, Geoffrey.« Das Schnauben der gänzlich in schwarz gekleideten Frau ist mir noch lebhaft in Erinnerung. »Wenn sie sich nicht an deine Regeln halten, wie kann man dann sicher sein, dass sie Befehle korrekt ausführen?« Mit etwas mehr Schwung als nötig drückten ihre Finger den Knopf neben der Fahrstuhltür.
Читать дальше