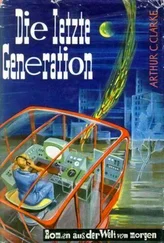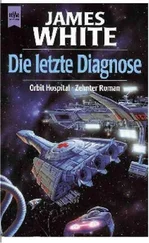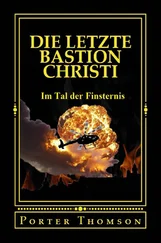Danael ließ einen Pfeil von der Sehne schnellen. Über die Hälfte verschwand im Wasser, doch der Rest wackelte so heftig, dass Leones alarmiert das Schwert hob. Was auch immer der Pfeil getroffen hatte, bewegte sich.
Plötzlich blitzte unter Wildfangs Bauch etwas auf und stieß senkrecht nach oben. Der Greif schrie. Danael schoss und griff bereits nach dem nächsten Pfeil. Wildfangs Flügelschläge verloren an Kraft. Leones sah Sturmlöwe vor Anstrengung zittern. Vergeblich zerrte er an Wildfangs Nacken. Wieder und wieder glänzte auf, was aus dem Weiher nach dem Greif stach. Fluchend jagte Danael Pfeil um Pfeil ins Wasser, doch es half nichts. Wildfangs Bewegungen erlahmten bereits, und er hing immer noch fest.
»Weg da!«, schrie Leones. Hektisch klopfte er mit der freien Hand auf den anderen Arm, um Sturmlöwe zu sich zu rufen. Einen Lidschlag lang verhüllte sein Atem ihm den Blick wie der Nebel. Als er den Weiher wieder sah, stiegen vereinzelte Blasen darin auf. Irgendwo zur Linken plätscherte es. Zur Rechten schmatzte Schlamm. Mit aufgelegtem Pfeil fuhr Danael herum, doch er schien ebenso wenig zu sehen wie Leones, denn er schoss nicht.
Wildfang stürzte ins Wasser, dass es mit lautem Klatschen aufspritzte und in den Weiher prasselte wie Regen. Reglos blieb er liegen, während sich Sturmlöwe höher schwang und auf Leones zukam. Überall schien es plötzlich leise zu schwappen und zu plätschern.
»Wir müssen hier weg!«, warnte Leones.
Widerwillig löste sich Danael vom Anblick seines Greifs. Der Zwiespalt stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben.
»Er ist tot. Du kannst nichts mehr für ihn tun«, drängte Leones. Hastig drehte er sich um. Hatte nicht direkt hinter ihm …
Etwas Glänzendes hob sich aus dem Weiher. Im ersten Augenblick sah er nur triefendes Wasser und schlaffe Stängel, doch dann erkannte er darunter die Axt. Eine schwarze Hand hielt den Stiel gepackt. Überall wallte und wogte das Wasser. Hände und Waffen tauchten daraus auf.
Leones spürte Sturmlöwe neben sich landen. »Komm!«, rief er Danael zu und sprang auf den Rücken des Greifs. Schon wollte sich Sturmlöwe vom Boden abstoßen. Rasch streckte Leones die Hand nach seinem Kameraden aus. Danael griff zu. Sie waren zu schwer, der Greif würde sie nicht beide in Sicherheit tragen können, doch Leones sah, wie sich Danaels Blick nach innen wandte. Der Sohn Heras beschwor seine Magie. Sturmlöwe schwang sich in die Luft. Für einen Moment riss Danaels Gewicht an Leones’ Arm, zog ihn beinahe vom Rücken des Greifs, dann wirkte plötzlich der Zauber, und Danael wurde leicht wie eine Feder. Seine Hand umklammerte Leones’ so fest wie zuvor, sie fühlte sich ebenso stark und warm an, und doch schwebte der Sohn Heras nun schwerelos neben ihm. Solange Danaels Magie nicht versiegte, musste er ihn nur noch festhalten.
Leones bemerkte Danaels forschenden Blick. Sorgte er sich, ob er dem Verräter vertrauen konnte? Worte würden daran nichts ändern. Besorgt sah Leones nach unten. Unzählige Tümpel schimmerten zwischen den Nebelfetzen im Mondlicht – und in allen regten sich die Toten einer längst geschlagenen Schlacht.
* * *
Mit dunklen Ahnungen blickte Laurion zur Elfenstadt Everea zurück. Selbst im fahlen Licht der dunstverschleierten Sonne schimmerten die Schilfdächer golden, und an den Giebeln glänzte Perlmutt mit silbernen Fahnen um die Wette. Wie passte so viel Schönheit nur zu so viel Argwohn und Hass? Wie konnten so hartherzige Wesen so anmutige, zerbrechliche Gebäude hervorbringen? Gab es unter den Elfen, die sich auf den Stegen drängten, denn niemanden, der Mitleid mit ihnen empfand? Viele von ihnen waren selbst Flüchtlinge und hatten gerade ihr Zuhause verloren. Die riesige Flutwelle hatte ihnen alles genommen, Angehörige und Freunde, Boote und Häuser. Sie standen ebenso vor dem Nichts wie die Dionier. Doch dass sie Elfen und Laurion und seine Begleiter Menschen waren, schien ein unüberwindliches Hindernis zu sein. Dieser Älteste, Ameahim, hatte Mahanael sogar als Verbrecher beschimpft, weil er gewagt hatte, zwei Dutzend Menschen in die Elfenlande zu bringen. Als ob sie Räuber, Mörder oder gar eine tödliche Krankheit wären. Wenn der Morgen mit einer blutroten Sonne beginnt …
Die Kemethoë und die Kaysas Segen wurden nun von schlanken Schiffen voll finster blickender Krieger eskortiert. Wie alle Abkömmlinge Ameas trugen sie blaue Gewänder, aber auch Rüstungen aus riesigen Fischschuppen und poliertem Horn. Einige hielten Schilde aus den Panzern großer Wasserschildkröten, und fast alle hatten sich mit Speeren bewaffnet, deren Spitzen Schilfblättern nachempfunden waren.
Misstrauisch spähte Otreus zu ihnen hinüber. »Hab ich nicht gleich gesagt, dass wir hier nicht willkommen sind? Wir hätten fliehen sollen, solange wir noch konnten.«
Die Regentin warf ihrem Leibwächter einen strafenden Blick zu. Sah er denn nicht, dass es weit und breit keine Zuflucht für sie gab? »Ihr Fürst erwähnte diese Grenzwächter, die über unser Schicksal entscheiden werden, also gibt es noch Hoffnung. Wenn wir uns vollkommen friedlich verhalten, können wir bestimmt ihr Vertrauen gewinnen.«
Otreus schnaubte, und alle anderen mieden Nemeras Blick. Es tat Laurion leid, aber auch ihm fiel es angesichts der vielen Waffen schwer, noch an ein gutes Ende zu glauben. Angeblich hatte Ameahim seinen Leuten nur befohlen, sie zu einer Insel zu bringen, die weit genug von der Stadt entfernt lag, damit die Menschen den Elfen nicht gefährlich werden konnten. Doch entsprachen seine Worte der Wahrheit? Was erwartete sie dort wirklich? Die Mienen der Elfenkrieger verhießen nichts Gutes.
Rasch gerieten die Häuser Evereas außer Sicht, und schon bald verlor Laurion im Labyrinth aus Wasser, Sandbänken, Auwald und Schilf die Orientierung. Die Gegend erinnerte ihn an das Delta des Mekat, wo die Fürsten von prunkvollen Barken aus Vögel gejagt hatten, aber hier war es kälter, und die einzigen Bogenschützen trieben dionische Flüchtlinge vor sich her. Einmal tauchte aus der Wildnis eine flache Brücke über einen abzweigenden Wasserweg auf – ein einsamer Beweis, dass sie sich noch in der Nähe der Stadt befanden. Die Elfen bogen jedoch nicht dorthin ab. Schweigend starrten sie zu den Menschen herüber, und einige – wie Otreus – blickten feindselig zurück. Lange Zeit war das leise Plätschern um die Schiffe der einzige Laut in der Stille.
»Dort könnt ihr landen und euer Lager aufschlagen!«, rief schließlich jemand auf dem vordersten Elfenschiff und deutete auf einen schmalen Sandstrand. Dahinter erhob sich lichter Wald.
»Es ist euch verboten, diese Insel zu verlassen«, warnte der Elf. »Wer dagegen verstößt, erweist sich als Feind und wird auf der Stelle getötet!«
»Was müssen Menschen ihnen angetan haben, dass sie uns so sehr misstrauen?«, fragte Nemera traurig.
Laurion konnte nur nicken. Der Hass der Elfen schien beinahe ebenso tief zu reichen wie die Bosheit der Drachen. Umso mehr verwunderte ihn, dass die Schiffe davonfuhren, sobald die Kemethoë und die Kaysas Segen am Ufer lagen und ausgeladen wurden.
»Ha!«, platzte Otreus heraus. »Woher wollen die Dreckskerle wissen, dass wir bleiben? Steigen wir wieder ein und verschwinden, Herrin!«
»Kannste allein machen, Hornochse«, brummte Djefer. Der stämmige Fischer schulterte, was von ihrem Kornsack geblieben war, und sprang damit an Land. »Das riecht nach Falle wie’n gammliger Fisch.«
»Du bist doch bloß zu feige, weil du Stümper den Kahn nicht schnell genug bekommst!«
»Hört auf damit!«, befahl Nemera. »Wir sind alle erschöpft und enttäuscht. Aber wir dürfen uns nicht provozieren lassen! Wenn wir uns keinen Fehler leisten, werden die Elfen erkennen, dass wir nicht ihre Feinde sind.«
»Euer Schiffsführer hat recht«, meinte Mahanael ernst. Der Elf war von Bord der Kaysas Segen gesprungen und hatte geholfen, sie höher auf den Strand zu ziehen. »Die Abkömmlinge Ameas werden euch im Auge behalten, auch wenn ihr sie nicht seht. Es sind ihre Inseln, und sie wissen sich lautlos in Wasser und Schilf zu bewegen.«
Читать дальше