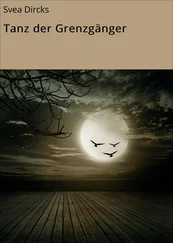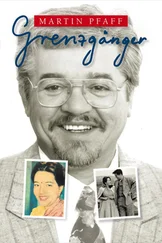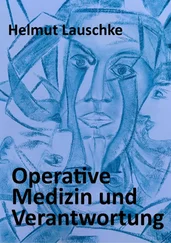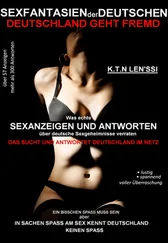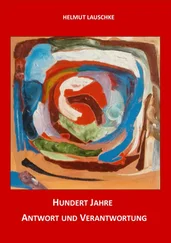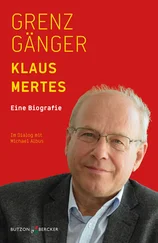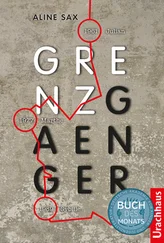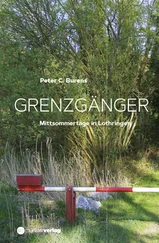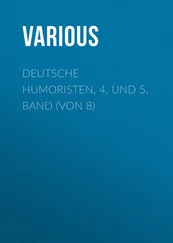Ich hatte zwei Jahre zuvor bei meinem ENA-Praktikum an der Regionalpräfektur in Metz die geräuschlose Ingangsetzung der Verfahren zum Bau des Kernkraftwerks Cattenom in Lothringen an der Mosel miterlebt: durch „Aushang“ an den zuständigen örtlichen Stellen. Die Nachbarn Luxemburg und Saarland – das Kraftwerk ist 10 bzw. 20 km von der Grenze entfernt! – wurden sorgfältig ferngehalten und erst nach Jahren immer wieder vorgetragener Proteste immerhin in die Notfallplanung miteinbezogen.
In gewisser Weise sind Fessenheim und Cattenom bis heute Stein des Anstoßes in Deutschland, vor allem in den Grenzregionen. Zusammen mit Tschernobyl und Fukushima haben sie dazu beigetragen, dass die Nuklear-Skepsis in Deutschland zugenommen hat und Frankreich und Deutschland in der Energiepolitik auseinandergedriftet sind.
Ahnen konnte ich damals nicht, dass mich Jahre später als Aufsichtsrat eines deutschen bekannten Energieversorgers – EnBW, Energie Baden-Württemberg – Kernenergie wieder beschäftigen würde und zudem eine alte Bekannte aus dem Elysée in Paris mich dazu einladen wollte, wieder in die Nuklear-Politik einzusteigen. Sie bot mir die Leitung dessen an, was in Deutschland von der Kraftwerk Union, der KWU geblieben war, der ich einst als Praktikant verbunden war. Ich habe, Gott sei Dank, noch rechtzeitig die Falle bemerkt und abgewunken! Sie suchte in Wahrheit, und zwar unter Umgehung und wohl gegen den Willen des deutschen Mitaktionärs Siemens einen deutschen „Abwickler“ oder „Sündenbock“ für das Scheitern nuklearer Zusammenarbeit.
Diese erste Praxiserfahrung im Auswärtigen Amt brachte mich mit zwei Lehrmeistern zusammen, die meinen Weg beeinflussen sollten, einerseits mit Werner Rouget als meinem Referatsleiter, dessen Erinnerungen ich 1997 nach seinem viel zu frühen Tod gemeinsam mit dem Frankreich-Kenner Ernst Weisenfeld herausgegeben habe 1, und andererseits mit Hanns-Werner Lautenschlager, dem späteren langjährigen Staatssekretär des Auswärtigen Amtes; damals war er „noch“ mein Abteilungsleiter.
Erster Aufenthalt in Madrid
Ähnlich spannend waren einige Monate an der Botschaft in Madrid. Vertiefung der spanischen Sprachkenntnisse war die Zielsetzung, doch weitaus interessanter war es, erstmals – und das ohne Verantwortung – eine Botschaft in der Praxis kennen zu lernen und vor allem Spanien auf seinen ersten Schritten Richtung Demokratie nach dem Tode Francos näher zu beobachten.
Dank des von der Botschaft engagierten Sprachlehrers hatten wir die Chance, den ersten Persönlichkeiten dieser jungen Demokratie, auf der rechten wie auf der linken Seite, zu begegnen oder zum Schrecken der Botschaft dank spanischer Studenten aus dem Umkreis der Sozialisten die erste große Demonstration der spanischen KP aus unmittelbarer Nähe mitzuerleben. Die spanische Kommunistische Partei wollte damals den Regierenden zeigen, dass sie unverändert in der Lage ist, Massen zu mobilisieren. Es waren 500.000 Menschen an der Plaza Colon in Madrid und über dem Platz kreiste lange Zeit ein Militär-Hubschrauber. Erst längere Zeit danach wurde bekannt, dass der spanische König die Machtdemonstration der KP „von oben“ beobachtete. Der Botschafter selbst schien entsetzt über eine solche „Naivität“ der Jung-Diplomaten, wir konnten so aber die Stimmung und Herausbildung einer jungen und zugleich wehrhaften Demokratie miterleben.
Es war für mich als jungen Attaché zugleich faszinierend, mit einem Mann der konservativen Rechten, Manuel Fraga Iribarne, über seinen Verfassungsentwurf diskutieren zu dürfen, der (sehr) der Verfassung der V. Republik in Frankreich nachgebildet schien, oder eben mit jungen Sozialisten um Felipe Gonzalez an langen Abenden über den Weg Deutschlands nach dem Kriege und den der deutschen Sozialdemokratie zu disputieren. Ich verstand nicht, wie die deutsche Politik – mit Ausnahme von Willy Brandt – gerade dieses Talent einschätzte. Dieses Land sollte mich auch in der Folge nie mehr loslassen.
Einblick in eine andere Welt: Arabisch-Kurs in Kairo
Meine Neugierde für die arabische Sprache hatte mir zudem nach einem einjährigen abendlichen „Schnupperkurs“ an der Universität in Bonn einige Monate Intensivkurs an der Botschaft Kairo beschert, den Einblick in eine andere Welt, in ein anderes Denken, in eine andere Kultur. An sich sollte es damals für einige Monate in den Libanon gehen in eine der anerkanntesten Sprachschulen in Shemlan – der aufkommende Bürgerkrieg hatte die Schule aber gezwungen, nach Kairo auszuweichen.
„Total immersion“ nennt man in der Fachsprache einen solchen Kurs – täglich 6 Stunden Sprachunterricht, daneben eine nur sehr lockere Anbindung an die Botschaft, dafür in größerer Intensität der Einblick in das Leben dieser Millionenstadt, im Grunde kulturell weniger arabisch, denn ägyptisch geprägt. Daraus wurde zugleich ein echter, ungeschminkter Einblick in das politische und gesellschaftliche Leben Kairos, einschließlich der religiösen Grundfragen, eine Möglichkeit, die wir als Mitarbeiter der Botschaft nicht in der gleichen Weise erhalten hätten.
Es waren faszinierende Monate in einem sich langsam öffnendem Lande, ein erster Einblick in eine gänzlich andere Welt – ungemein lehrreiche Monate, von denen ich bis in die jüngste Zeit profitieren sollte.
Es war zugleich die Neugierde für diesen geopolitisch und nachbarschaftlich für Europa so wichtigen Raum, die vielleicht mitursächlich für die erste längerfristige Verwendung wurde: Algier, die erste klassische, nicht minder lehrreiche Auslandsverwendung mit dem schwierigen Lernposten Algier als Leiter des Rechts- und Konsular- sowie des Kulturreferats – eine überraschende Postenkombination, die mich zunächst einmal nachdenklich machen musste.
2. Lehrjahre in Algier: 1978–81
August 1978, Ankunft in Algier, eine Hauptstadt im Leerlauf, ja fast in Agonie, Zeit des Ramadan, nicht nur! Ein Land in der Erwartung des Todes seines langjährigen Präsidenten Houari Boumédiène – und parallel wurde anscheinend ohne Ende zwischen den Spitzen der Armee und der Einheitspartei FLN über die Nachfolge verhandelt …
Dass das junge Land 15 Jahre nach Erlangung seiner Unabhängigkeit und einem erbitterten Krieg mit seinem Mutterland Frankreich noch nicht im Reinen sein konnte, konnte nicht erstaunen – dass dies heute, über 50 Jahre nach der Unabhängigkeit immer noch nicht der Fall ist, muss indes verwundern.
Dass das Land – oder besser gesagt, die Führer von Armee und der legendären Staatspartei FLN – sich 1978 schwertaten, einen Nachfolger für den langjährigen Präsidenten zu küren, schien noch verständlich. Aber dass das Land 35 Jahre später den kranken Staatspräsidenten Abdelaziz Bouteflika – der schon zu meiner Zeit zur Führung gehörte – sanft überreden musste, mangels Einigung über einen Nachfolger wie auch wohl, so bedeuteten mir Insider, mangels Verständigung über die Sicherheitskautelen für seine Familie weiter im Amt zu bleiben, musste zu ernsten Bedenken führen!
Auch nach dem Tode Bouteflikas und der Wahl eines neuen Präsidenten bleibt das Land in einer labilen Lage. Es gelingt der Führung nicht, die Demonstrationen und Rufe nach mehr Demokratie und Gerechtigkeit zu befriedigen. Die Armee als wesentliches herrschendes Führungselement scheut sich vor überfälligen Reformen und Schritten zu mehr Demokratie. Dies in einem Land, das von den Naturschätzen zu den reichsten Ländern der Welt gehört, das aber systembedingt nur schwer vom Fleck kommt.
Liegt dies an dem Trauma der durch den Kampf gegen den extremen Islamismus verlorenen 90er Jahre oder eben an jenem „historischen“ Kompromiss zwischen Armee und politischer Führung, verkörpert durch die FLN, die sich in Wahrheit überlebt haben scheint, und auf der anderen Seite „gemäßigten“ Islamisten, die ihren Einfluss mehr und mehr ausbreiten? Kritiker werfen dem „Regime“ vor, zum Schaden des Landes die Gesellschaft – vor allem mit der schleichenden Übernahme des Bildungsbereichs – letztlich den Islamisten zu überlassen. Oder spielt nicht doch noch in den Hinterköpfen vieler in Algerien das nach wie vor durch latente Spannungen und Missverständnisse beherrschte Verhältnis zum kolonialen Mutterland Frankreich eine besondere Rolle? Die Ereignisse des Jahres 2019 und die spürbare Angst vor einem demokratischen Wandel haben dies nachdrücklich unterstrichen.
Читать дальше