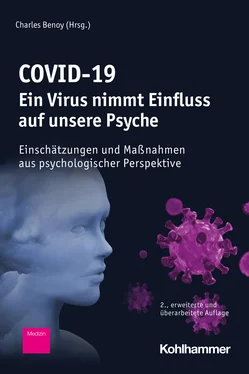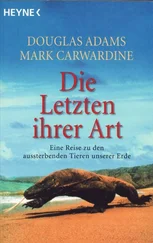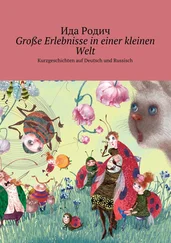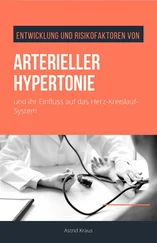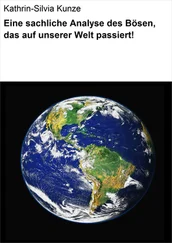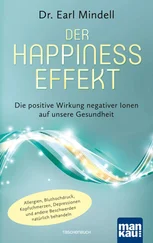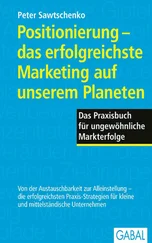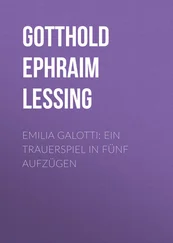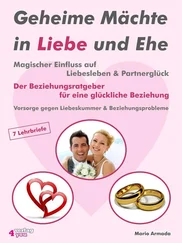gilles.michaux@hopitauxschuman.lu
Neuser, Violaine
Dipl-Psychologin
GesondheetsZentrum, Fondation Hôpitaux R. Schuman
44, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg
violaine.neuser@hopitauxschuman.lu
Reuter, Jean, Dr. med.
Facharzt für Intensivmedizin
Centre Hospitalier de Luxembourg
4, rue Ernest Barblé, L-1210 Luxembourg
reuter.jean@chl.lu
Schatto-Eckrodt, Tim, M.A.
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Institut für Kommunikationswissenschaft
Bispinghof 9-14, D-48143 Münster
tim.schatto-eckrodt@uni-muenster.de
Schulze, Hartmut, Prof. Dr. phil.
Dozent und Leiter des Instituts für Kooperationsforschung und -entwicklung
Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Angewandte Psychologie
Riggenbachstrasse 16, CH-4600 Olten
hartmut.schulze@fhnw.ch
Schumann, Frank
Projektleiter
Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e. V.
Fachstelle für pflegende Angehörige
Am Südstern 8–10, D-10961 Berlin
f.schumann@diakonie-stadtmitte.de
Sischka, Philipp E., Dr.
Research Scientist
Université du Luxembourg
Department of Behavioural and Cognitive Sciences
11, Porte des Sciences, L-4366 Esch-sur-Alzette
philipp.sischka@uni.lu
Sollberger, Daniel, PD Dr. med. Dr. phil.
Chefarzt und stv. ärztlicher Direktor
Erwachsenenpsychiatrie Baselland
Bienentalstrasse 7, CH-4410 Liestal
daniel.sollberger@pbl.ch
Stadler, Christina, Prof. Dr. phil. Dr. med.
Klinische Professorin und Leitende Psychologin
Klinik für Kinder und Jugendliche der Universitären Psychiatrischen Kliniken
Wilhelm Klein-Strasse 27, CH-4002 Basel
christina.stadler@upk.ch
Steffgen, Georges, Prof. Dr. rer. nat.
Professor für Sozial- und Arbeitspsychologie
Université du Luxembourg
Department of Behavioural and Cognitive Sciences
11, Porte des Sciences, L-4366 Esch-sur-Alzette
georges.steffgen@uni.lu
Tammen-Parr, Gabriele
Projektleiterin
Pflege in Not – Beratungs- und Beschwerdestelle bei Konflikt und Gewalt in der
Pflege älterer Menschen
Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e. V.
Bergmannstr. 44, D-10961 Berlin
info@tammen-parr.de
Vögele, Claus, Prof. Dr.
Professor für Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie
Université du Luxembourg
Department of Behavioural and Cognitive Sciences
11, Porte des Sciences, L-4366 Esch-sur-Alzette
claus.voegele@uni.lu
Walitza, Susanne, Prof. Dr. med. Dipl.-Psych.
Klinikdirektorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -Psychotherapie
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich
Neumünsterallee 9, CH-8032 Zürich
susanne.walitza@puk.zh.ch
Walter, Marc, Prof. Dr. med.
Chefarzt und stv. Klinikdirektor
Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel
Wilhelm Klein-Strasse 27, CH-4002 Basel
marc.walter@upk.ch
Weichbrodt, Johann, Dr. sc.
Senior Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Teamleiter
Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Angewandte Psychologie
Riggenbachstrasse 16, CH-4600 Olten
johann.weichbrodt@fhnw.ch
Wolff, Kira, Dr. med.
Oberärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie
Zentrum für Psychische Gesundheit
Universitätsklinikum Frankfurt
Heinrich-Hoffmann-Straße 10, D-60528 Frankfurt am Main
kira.wolff@kgu.de
Geleitwort: Wenn du das Virus aushalten willst, richte dich auf den Widerstand ein – ein philosophischer Kommentar
Olivier Del Fabbro
1910, im Antlitz des 1. Weltkrieges, schreibt der US-amerikanische Philosoph, Psychologe und Arzt William James einen Aufsatz mit dem Titel The Moral Equivalent of War – Das moralische Äquivalent des Krieges (James 1987). James behauptet hier, dass die Geschichte ein Blutbad ist – »History is a bath of blood« (James 1987, S. 1282). Die Aussage bezieht sich auf die brutale und grausame Menschheitsgeschichte, die zahlreichen Kriege, Revolutionen und bewaffneten Kämpfe jeglicher Art.
James’ Essay will dem Krieg den Krieg erklären. Doch auch wenn James sich als Pazifist sieht, ist er nicht ›naiv‹, wie er selbst zugibt. Er weiß nur zu gut, dass Kriegsbefürworter sich nicht von Friedensrhetorik überzeugen lassen. Patriotismus oder Skepsis am ›Gutmenschentum‹, wie man heute sagt, sind zu tief im Idealismus solcher Kriegsbefürworter verankert. Wie aber sollen letztere überzeugt werden?
James sieht zwei Möglichkeiten. Erstens muss man in den kriegerischen Tugenden, wie zum Beispiel der Furchtlosigkeit und dem Gehorsam von Befehlen, Werte sehen, die es auch heute noch zu verteidigen gilt. Und zweitens lassen sich diese Werte ohne Probleme auf den zivilen Alltag übertragen. Das Leben, so James, ist hart. Menschen schuften und erleiden alltäglich Schmerzen. Heroisch wird deswegen nicht mehr nur gegen eine gegnerische Armee gekämpft, sondern ganz allgemein gegen die Natur. Fensterputzer und Tellerwäscher, Minenarbeiter und Straßenbauer, sie alle, so James weiter, bezahlen ihre Blutsteuer im alltäglichen Kampf gegen die Natur.
Seit Beginn des Jahres 2020 wurde dies wieder besonders deutlich. Bereits kurz nach dem Ausbruch der Pandemie wurde kriegsmetaphorisch gesprochen: Macron, Trump und sogar der Papst äußerten sich über die Pandemie als Kriegssituation und bezeichneten das Virus als Gegner, den es zu bekämpfen gilt, wobei Ärzte und Pflegekräfte die Soldaten sind, die an der Front kämpfen (Del Fabbro 2020, S. 16 f.). Doch mittlerweile kämpfen, nach den vielen Restriktionen und unzähligen Ausgangssperren, nicht mehr nur Ärzte und Pflegekräfte an der Front, auch der Alltagsbürger und die Bevölkerung selbst befinden sich im Krieg. Die deutsche und die südkoreanische Regierung zum Beispiel versuchen mit Videokampagnen die Bürger ihres Landes, mal ironisch mit Witz und sarkastisch als Faulpelz auf der Couch (Bundesregierung 2020), mal als heldenhafte Kämpfer begleitet von dramatischer Musik (KCIS 2020), zu stilisieren und anzusprechen. Ersteres tritt wohl jenen zu Nahe, die an der Isolation, aus welchen Gründen auch immer, leiden. »Nichts tun«, wie es im Video heißt, ist nicht immer lustig. Das südkoreanische Video erscheint eher wie ein Propaganda-Video, das versucht, Leid und Elend angesichts der alltäglichen hochstilisierten Helden unter den Teppich zu kehren. Zur Propaganda dient auch die seit Winter 2020 installierte Ausstellung in Wuhan, die die Bekämpfung des Virus seitens der kommunistischen Partei Chinas glorifizierend darstellt (Wurzel 2020).
Doch wer in den Krieg zieht, benötigt realistisch betrachtet weit mehr als nur Ideologie, kriegerische Tugenden oder Witz. Es benötigt auch Handfestes wie logistische Organisation, Strategie, Material, heute wie immer schon die jeweils verfügbaren hochtechnologischen Waffen, gut ausgebildete Soldaten. Die Kriegsgeschichte lehrt uns, dass derjenige mit den besseren Waffen und der schlaueren Strategie gewinnt und nicht Moral oder Ideologie (Morris 2015). Doch wie schützen Menschen sich gegen die sie bedrohende Natur? Wie passen sie sich dieser Bedrohung an? Welche Strategie entwickeln sie?
Solche Probleme werden heute nicht individuell, sondern strukturell, d. h. institutionell angegangen. Von Ministerien oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bis hin zu Krankenhäusern und Altenheimen. Egal, wie diese Institutionen konkret organisiert sind, sie alle haben eine duale Machtstruktur, die sich von der Makrostruktur der Entscheidungsträger bis zur Mikrostruktur der einzelnen vor Ort operierenden Akteure durchzieht. Je mehr eine Institution auf ihre auf dem Feld Operierenden hört, weil diese am meisten Einblick in die Sachlage haben, desto pragmatischer, will heißen: anpassungsfähiger an neue Problemlagen ist sie (Ansell 2011). Es geht also nicht darum, Hierarchien aufzulösen, sondern Entscheidungsträger, d. h. Manager, Generäle und Politiker davon zu überzeugen, dass der einzelne Soldat, Arzt, Pfleger auf dem Schlachtfeld keine passive Marionette, sondern ein aktiver Bestandteil des funktionierenden Apparates ist.
Читать дальше