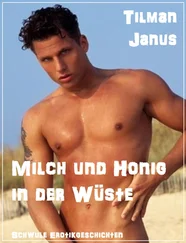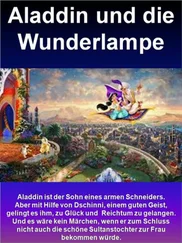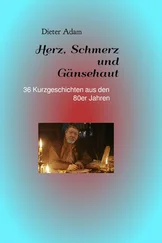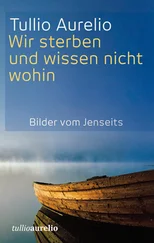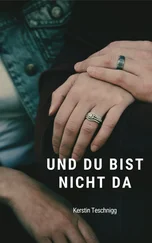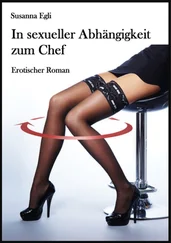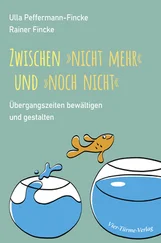Veränderungen des Schlafes, insbesondere die Unterdrückung und Fragmentierung des REM (Rapid-eye-movement)-Schlafs sind oft bei chronischem Alkoholkonsum zu beobachten. Im Alkoholentzug kommt es zum REM-rebound und es können im EEG pathologische REM-Schlaf ähnliche Muster auftreten, die im Delir kurzzeitig bis zu 100 % des EEG-Musters ausmachen können. Die Veränderungen des Schlafes im Alkoholentzug werden wahrscheinlich dadurch verursacht, dass Alkohol als positiver allosterischer Modulator der GABA A-Rezeptoren wegfällt. Zudem kommt es zu einer verminderten Dopaminwirkung und einer erhöhten Aktivierung von Stress Neuromodulatoren wie Hypocretin/Orexin, CRF und Cytokinen (Koob und Colrain 2020).
Eine MRS-Studie zeigte im Entzug (2,5 Tage nach dem letzten Alkoholkonsum) bei Alkoholkranken erniedrigte Konzentrationen von GABA (  -Aminobuttersäure) und Glutamin, aber nicht von Glutamat im präfrontalen Cortex im Vergleich zu »Normaltrinker« (Prisciandaro et al. 2019b). Zudem kommt es zu einem vorübergehenden Wegfall der supprimierenden Wirkung des Alkohols, v. a. auf GABA-Rezeptoren und damit zu einer verringerten Hemmung des Erregungsniveaus im ZNS. Dies kann zu Krampfanfällen führen, denn GABA ist der wichtigste hemmende Neurotransmitter im ZNS. Nach etwa einer Woche haben sich die GABA-Konzentrationen dann wieder normalisiert (Prisciandaro et al. 2019c).
-Aminobuttersäure) und Glutamin, aber nicht von Glutamat im präfrontalen Cortex im Vergleich zu »Normaltrinker« (Prisciandaro et al. 2019b). Zudem kommt es zu einem vorübergehenden Wegfall der supprimierenden Wirkung des Alkohols, v. a. auf GABA-Rezeptoren und damit zu einer verringerten Hemmung des Erregungsniveaus im ZNS. Dies kann zu Krampfanfällen führen, denn GABA ist der wichtigste hemmende Neurotransmitter im ZNS. Nach etwa einer Woche haben sich die GABA-Konzentrationen dann wieder normalisiert (Prisciandaro et al. 2019c).
Im Alkoholentzug sind noch weitere Neurotransmittersysteme gestört (Junghanns und Wetterling 2017). Bei einem schweren Alkoholentzugssyndrom, insbesondere beim Alkoholentzugsdelir, kann es auch zu Elektrolytstörungen kommen (Wetterling et al. 1994).
4.2 Membranhypothese
4.2.1 Akute Wirkungen
Die sogenannte »Membranhypothese« geht davon aus, dass sich Alkohol aufgrund seiner Wasser- und Fettlöslichkeit in die Lipiddoppelschicht der Zellmembranen einlagern und dadurch deren Struktur verändern kann. Dadurch werden die in dieser Lipiddoppelschicht eingelagerten Ionenkanäle und Rezeptoren der Nervenzellen in ihrer Funktion beeinflusst. Die vorliegenden Daten sprechen aber dafür, dass diese Effekte erst bei sehr hohen Alkoholkonzentrationen (= »narkotische Wirkung«) zu beobachten sind (Most et al. 2014).
4.2.2 Veränderungen bei chronischem Alkoholkonsum
Über eine Reihe von Stoffwechselwegen (z. B. Bildung von Acetaldehyd und oxidativem Stress) kann chronischer Alkoholkonsum zur Schädigung von Glykokonjugaten führen. Diese sind ein wichtiger Bestandteil der Zellmembranen (Übersicht Waszkiewicz et al. 2012). Acetaldehyd kann die Blut-Hirnschranke nicht durchdringen, aber im ZNS kann Acetaldehyd gebildet werden (Heit et al. 2013).
Das Myelin, das die Nervenzellen im ZNS umhüllt, ist zu wesentlichen Teilen aus Lipiddoppelschichten aufgebaut, die zahlreiche Glykolipide enthalten. Diese können durch Alkohol geschädigt werden (Nickel und Gu 2018). Diffusion tensor imaging (DTI)-Studien zeigen, dass die weiße Hirnsubstanz, die zu großen Teilen aus Myelin gebildet wird, in Abhängigkeit vom Schweregrad der Alkoholabhängigkeit geschädigt ist (Monnig et al. 2015). Inwieweit diese Schädigungen bei einer längeren Abstinenz reversibel sind, ist noch nicht geklärt (Monnig et al. 2013).
Zu erwähnen ist auch, dass chronischer Alkoholkonsum eine Veränderung der Darmpermeabilität verursachen kann und damit die Aufnahme »toxischer« Stoffe und auch Bakterien in den Körper fördern kann. Diese Prozesse können möglicherweise mit der Alkoholkrankheit assoziiert sein (Leclercq et al. 2019).
4.3 Epigenetische Prozesse
Epigenetische Prozesse sind hoch komplex (Bauer 2019; Jangra et al. 2016). Vereinfacht gesagt, steuern sie die Ablesung des genetischen Codes, der DNA. Sie bestimmen die Teile des Codes, die abgelesen werden und dann über eine Reihe von Schritten z. B. die Synthese bestimmter Proteine (Enzyme, Rezeptoren etc.) veranlassen. Das Ablesen des genetischen Codes (Transkription) kann durch epigenetische Mechanismen gefördert (z. B. durch Acetylierung der Histone) oder vermindert (z. B. Methylierung der Histone) werden. Die Histone fungieren dabei als eine Art Reaktionszentrum. Eine Methylierung an bestimmten Stellen der DNA (CpG) beeinflusst ebenfalls die Genexpression. Eine Hypermethylierung führt zu einer Hemmung der Transkription, während eine Hypomethylierung die Ablesung des entsprechenden Genabschnitts erlaubt.
Eine Reihe von Umwelteinflüssen u. a. auch psychische Belastungen, können epigenetische Prozesse beeinflussen (Bauer 2019). Alkoholkonsum beeinflusst eine Reihe von Stoffwechselvorgängen, die sich auf epigenetische Prozesse auswirken. Diese sind mitverantwortlich für Schädigungen des Gehirns (Jangra et al. 2016) und anderer Organe (Moghe et al. 2011; Varela-Rey et al. 2013) bei längerem (hohen) Alkoholkonsum. So bewirkt Alkohol u. a.:
 Histon-Modifikationen. Es kommt je nach aktuellen Bedingungen zu einer Acetylierung und Methylierung der Histone. Die dafür zuständigen Enzyme werden durch Alkohol beeinflusst, insbesondere durch eine vermehrte Produktion von NADH (Moghe et al. 2011).
Histon-Modifikationen. Es kommt je nach aktuellen Bedingungen zu einer Acetylierung und Methylierung der Histone. Die dafür zuständigen Enzyme werden durch Alkohol beeinflusst, insbesondere durch eine vermehrte Produktion von NADH (Moghe et al. 2011).
 eine Methylierung der DNA kann durch Alkoholkonsum beeinflusst werden, denn S-Adenosyl Methionin, das als Quelle der Methylgruppen fungiert, wird beim Abbau von Alkohol in größeren Mengen verbraucht und somit seine Konzentration verringert (Parira et el. 2017). Durch hohen Alkoholkonsum wird die Produktion von Folsäure sowie dessen Aufnahme aus dem Darm verringert (Martin et al. 2003). Folsäure ist für den Methylierungsprozess erforderlich.
eine Methylierung der DNA kann durch Alkoholkonsum beeinflusst werden, denn S-Adenosyl Methionin, das als Quelle der Methylgruppen fungiert, wird beim Abbau von Alkohol in größeren Mengen verbraucht und somit seine Konzentration verringert (Parira et el. 2017). Durch hohen Alkoholkonsum wird die Produktion von Folsäure sowie dessen Aufnahme aus dem Darm verringert (Martin et al. 2003). Folsäure ist für den Methylierungsprozess erforderlich.
Viele, v. a. tierexperimentelle Studien sprechen auch für eine Beteiligung epigenetischer Mechanismen bei der Entwicklung einer Alkoholabhängigkeit ( 
Kap. 7.1.4
). Durch epigenetische Mechanismen, die durch Alkoholkonsum beeinflusst werden, sind auch einige der Langzeiteffekte von Alkohol erklärbar.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
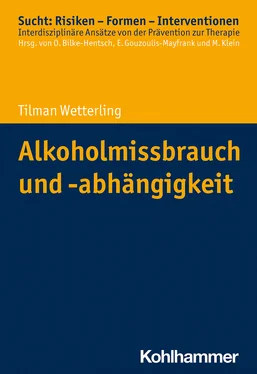
 -Aminobuttersäure) und Glutamin, aber nicht von Glutamat im präfrontalen Cortex im Vergleich zu »Normaltrinker« (Prisciandaro et al. 2019b). Zudem kommt es zu einem vorübergehenden Wegfall der supprimierenden Wirkung des Alkohols, v. a. auf GABA-Rezeptoren und damit zu einer verringerten Hemmung des Erregungsniveaus im ZNS. Dies kann zu Krampfanfällen führen, denn GABA ist der wichtigste hemmende Neurotransmitter im ZNS. Nach etwa einer Woche haben sich die GABA-Konzentrationen dann wieder normalisiert (Prisciandaro et al. 2019c).
-Aminobuttersäure) und Glutamin, aber nicht von Glutamat im präfrontalen Cortex im Vergleich zu »Normaltrinker« (Prisciandaro et al. 2019b). Zudem kommt es zu einem vorübergehenden Wegfall der supprimierenden Wirkung des Alkohols, v. a. auf GABA-Rezeptoren und damit zu einer verringerten Hemmung des Erregungsniveaus im ZNS. Dies kann zu Krampfanfällen führen, denn GABA ist der wichtigste hemmende Neurotransmitter im ZNS. Nach etwa einer Woche haben sich die GABA-Konzentrationen dann wieder normalisiert (Prisciandaro et al. 2019c). Histon-Modifikationen. Es kommt je nach aktuellen Bedingungen zu einer Acetylierung und Methylierung der Histone. Die dafür zuständigen Enzyme werden durch Alkohol beeinflusst, insbesondere durch eine vermehrte Produktion von NADH (Moghe et al. 2011).
Histon-Modifikationen. Es kommt je nach aktuellen Bedingungen zu einer Acetylierung und Methylierung der Histone. Die dafür zuständigen Enzyme werden durch Alkohol beeinflusst, insbesondere durch eine vermehrte Produktion von NADH (Moghe et al. 2011).