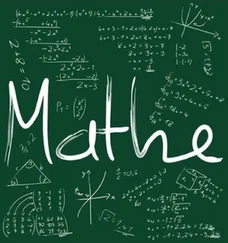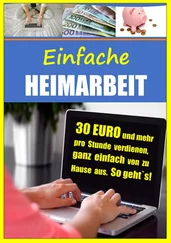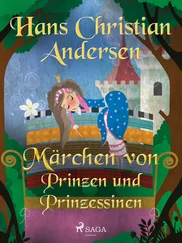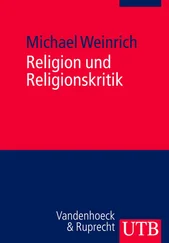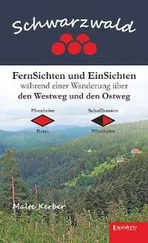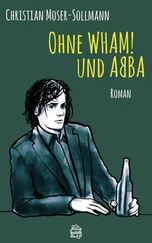Dabei besteht das Problem, dass sowohl der Säkularismus als auch religiöse Heilsordnungen beanspruchen, universelle Gültigkeit zu haben. Das bedeutet, dass beide aufgrund ihres Machtanspruchs fast zwangsläufig in einen Konflikt miteinander geraten müssen. Dabei besitze beide – also säkulare Ideologien wie religionistische Bewegungen – grosse Mobilisierungs- und damit auch Gewaltpotenziale, wie die jüngere und jüngste Geschichte gezeigt hat. Vielleicht wäre eine global gedachte und garantierte „citizenship“ eine Möglichkeit, dieses Konfliktpotenzial nachhaltig zu entschärfen.
Ich habe die Frage eines Weltstaates an verschiedenen Stellen eingehend diskutiert (vgl. Jäggi 2017a:298ff. sowie 2016c:131ff.). Deshalb hier nur so viel: Aus der Sicht einer interreligiösen Friedensethik wird man nicht darum herumkommen, die Frage nach einem gerechten und demokratischen Weltstaat neu zu stellen und auch konkrete Schritte zu seiner Verwirklichung einzuleiten. Entscheidend wird dabei sein, ob es gelingt, erstens einen weltumfassenden Grundkonsens über die gemeinsamen Grundwerte von Nationen und Religionen übergreifenden gesellschaftlichen Wertvorstellungen zu finden, zweitens diese auf übergreifende geistige und ethische Handlungsprinzipien auszurichten und drittens diese auch in Form von globalstaatlichen Institutionen umzusetzen. Und all dies muss auf der Grundlage der Menschenrechte geschehen.
Ausgehend von der sukzessiven Entwicklung und Entfaltung der Menschenrechtslehre im Rahmen einer Reihe von Verträgen und Abkommen, die im Grunde eine – wenn auch immer wieder von Rückschlägen unterbrochene – Erfolgsgeschichte darstellen, lassen sich nach Beitz (2009:27ff.) folgende Kategorien von Menschenrechten unterscheiden:
1) Rechte in Bezug auf die Freiheit und Sicherheit der Person: Dazu gehören das Verbot der Sklaverei, das Verbot von Folter sowie grausamer und brutaler Strafen, das Recht aller Menschen auf Anerkennung als Rechtsperson, Gleichheit vor dem Gesetz, Verbot willkürlicher Inhaftierung und die Unschuldsvermutung.
2) Rechte in der Zivilgesellschaft: Zu dieser Kategorie zählen Schutz der Privatheit in Familie, Heim und zwischenmenschlichen Beziehungen, Bewegungsfreiheit und freie Wahl des Wohnorts innerhalb des Staates, Recht auf Auswanderung, gleiches Recht zu heiraten für Männer und Frauen, gleiche Rechte in der Ehe, Recht auf Scheidung, Recht auf freie Zustimmung zur Heirat.
3) Politische Rechte: Bestandteil der politischen Rechte sind Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Recht auf Gründung von Vereinigungen, Recht auf Regierungsmitbestimmung im eigenen Land, Recht auf Teilnahme an Wahlen.
4) Ökonomische, soziale und kulturelle Rechte: Dazu gehören das Recht auf angemessenen Lebensstandard, Zugang zu geeigneter und genügender Ernährung, Kleidung, Unterkunft, medizinischer Versorgung, garantiertes Recht auf Grundschulunterricht, freie Wahl der Anstellung, gerechte und angemessene Entlöhnung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das Recht, einer Gewerkschaft beizutreten, vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und soziale Sicherheit.
Dazu ist laut Beitz (2009:28) eine weitere Menschenrechtskategorie zu ergänzen.
5) Rechte von Gruppen oder Communities als soziale Entitäten im Sinne von Selbstbestimmung und Autonomie der einzelnen Gemeinschaften, unter anderem über Selbstverwaltung, Kontrolle über natürliche Reichtümer und Ressourcen an Ort, korporative Glaubensfreiheit usw.
Neben der UNO-Menschenrechtskonvention von 1948 (vgl. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 und 1948b) bestehen folgende weitere Vereinbarungen:
– Pakt I (Sozialrechte): Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (ICESCR)
– Pakt II (Bürgerrechte): Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR)
– Antirassismuskonvention: Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung (ICERD)
– Antifolterkonvention: Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (CAT)
– Frauenrechtskonvention: Übereinkommen über die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW)
– Kinderrechtskonvention: Übereinkommen über die Rechte des Kindes (CRC)
– Wanderarbeiterkonvention: Übereinkommen zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen (ICRMW)
– Behindertenrechtskonvention: Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen (CRPD)
– Konvention gegen das Verschwindenlassen: Konvention gegen das Verschwindenlassen von Personen
– Weitere universelle Abkommen: Übereinkommen gegen Völkermord / Genfer Flüchtlingskonvention / Abkommen gegen den Menschenhandel / Römer Statut des Internationalen Strafgerichtshofs / Vertrag über den Waffenhandel / UNO-Migrationspakt / UNO-Flüchtlingspakt (vgl. Menschenrechtsabkommen der UNO 2019).
Wie man sieht, fehlt es weder an Abkommen noch an Absichtserklärungen. Das Problem liegt natürlich – wie alle wissen – bei der Anwendung und Durchsetzung dieser Forderungen auf lokaler, nationaler und globaler Ebene 20.
Johan Galtung (2000:13f.) hat folgende vier Forderungen für eine „Charta für die Globalisierung von Menschenrechten und -pflichten“ vorgeschlagen:
– Recht aller Weltbürger/innen auf freie Meinungsäusserung, Versammlungsfreiheit und die freie und geheime Wahl von Vertreterinnen und Vertretern der Mitglieder der UN-Vollversammlung bei gleichzeitiger Wahlpflicht;
– Anspruch aller Weltbürger/innen auf Schutz gegen Gewalt – durch wen diese auch immer ausgeübt wird – durch eine „Weltzentralbehörde“ bzw. Weltregierung und Pflicht aller Weltbürger/innen, „sich an friedensbewahrenden, mit friedlichen Mitteln durchgeführten militärischen und/oder zivilen Massnahmen zu beteiligen“ (Galtung 2000:13);
– Anspruch aller Weltbürger/innen auf eine menschenwürdige Existenz und Deckung ihrer materiellen Grundbedürfnisse auf der Grundlage von Erwerbstätigkeit bei gleichzeitiger Pflicht zur Entrichtung angemessener Weltsteuern;
– Anspruch aller Weltbürger/innen auf kulturelle Identität auf der Grundlage alter, traditioneller und neuer kultureller Inhalte bei gleichzeitiger Pflicht, „anderen im Dialog über kulturelle Inhalte, Sinngebungen und Identitäten mit Respekt zu begegnen“ (Galtung 2000:14).
2Die Frage, ob es überhaupt Ethiken geben kann, die nicht weltanschauungsbasiert sind, sei hier einmal offen gelassen, ich gehe an anderer Stelle darauf ein (vgl. Jäggi 2016a). Gemeint sind hier Ethiken, die aus klar umrissenen weltanschaulichen Kontexten heraus entstanden sind, etwa als „christliche“ oder „islamische“ Ethik, oder auch als „säkulare“ Ethik, die ohne Zweifel auch auf einer spezifischen – in diesem Fall einer säkularen – Weltanschauung beruht. Im Unterschied zu anderen ethischen Ansätzen – wie etwa der Diskursethik – basieren weltanschauungsbasierte Ethiken auf einem klar umrissenen und damit zwangsläufig partiellen Bezugsrahmen, etwa einer religiösen Weltanschauung, beanspruchen aber trotzdem darüber hinaus universelle Gültigkeit. Das gilt – mit Einschränkungen – auch für säkulare Ethiken, die ja auch aus einem bestimmten, sozial, politisch und historisch mehr oder weniger klar umrissenen Kontext heraus entstanden sind und ebenfalls universelle Gültigkeit beanspruchen.
3Ausführlich zu diesem Diskurs vgl. die Kapitel „Theologie der Befreiung als Ansatz?“ und „Diskursethik“.
4„For a rich, complex, and complete understanding of secularism, one must examine how the secular idea has developed over time trans-nationally” (Bhargava 2007:22).
5Als ich einmal diesen Einwand in einem Gespräch mit Hans Küng formulierte, lautete seine Antwort: „Das haben wir versucht, aber es hat nicht funktioniert“. Doch dass ein Ansatz „nicht funktioniert“ – also einer empirischen Überprüfung nicht standhält oder in der Praxis nicht anwendbar ist, kann sehr verschiedene Gründe haben: schlecht gewählte Rahmenbedingungen, mangelhafte Konstrukte, falsche oder unzureichende Operationalisierung, methodische Mängel usw. Allerdings hat Küng (1990:95) selber auch von jeder Religionsgemeinschaft gefordert, sich bewusst zu sein, „dass sie der ständigen Vergebung und Erneuerung bedarf“ – sich also auch in einem permanenten Wandlungs- und Lernprozess befindet.
Читать дальше