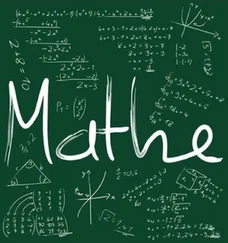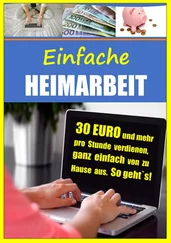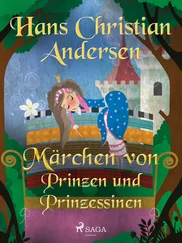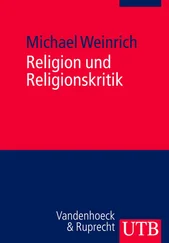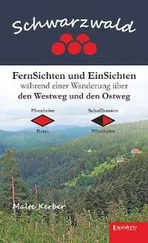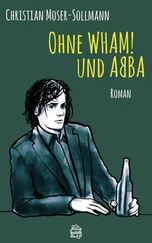Ins Zentrum seines Konzepts des überlappenden Konsenses stellt Rawls (1998:83) Reziprozität: Dabei gehe es um eine „Beziehung zwischen Bürgern, die in Gerechtigkeitsgrundsätzen zum Ausdruck kommt, welche eine soziale Welt ordnen, in der … ein jeder profitiert“. Allerdings sind im Rawls‘schen Sinn Reziprozität und gegenseitiger Vorteil nicht identisch (Rawls 1998:83). Entsprechend sei eine „symmetrische Stellung der Parteien zueinander … notwendig, wenn sie als Vertreter freier und gleicher Bürger betrachtet werden sollen, die unter fairen Bedingungen zu einer Übereinkunft gelangen“ (Rawls 1998:91).
Zu Recht weist Küng (1990:49) darauf hin, dass dieser politische Grundkonsens „in einem dynamischen Prozess stets neu gefunden werden“ werden muss. Doch das Problem ist, wie das geschehen kann und soll. Ausserdem besteht im heutigen öffentlichen Diskurs die Schwierigkeit, dass sich dieser „entweder aus technokratischen, auf Managementaspekte begrenzten Gesprächen oder aus höhst parteilichen, erbitterten Schaukämpfen [speist], deren Teilnehmer einander anschreien, anstatt sich auf eine vernunftgesteuerte Auseinandersetzung einzulassen“ (Sandel 2015:7). Dazu kommt, dass die Menschen in der Politik lieber grosse Themen abhandeln wollen, als sich mit sehr spezifischen und teilweise höhst komplexen Detailfragen auseinanderzusetzen (vgl. Sandel 2015:7). Dabei hat der heutige politische Mainstream-Diskurs Schwierigkeiten, sowohl die grossen politischen Fragestellungen als auch die komplexen Detailfragen und Zusammenhänge aufzugreifen und sachlich zu diskutieren.
Ein weiteres Problem besteht in der Umsetzung des – im günstigsten Fall – erlangten politischen Grundkonsenses in eine entsprechende vertikale Machtverteilung und Souveränität, und zwar auf lokaler, nationaler und Weltebene.
Dabei muss die Souveränität breit von oben nach unten – und von unten nach oben verteilt sein: Kommunale, lokale, nationale und globale Zuständigkeiten sind dabei erforderlich, ohne dass es zu Übergriffen von oben nach unten kommt. Viele Bundesstaaten verfügen bereits heute über vielfältige Erfahrungen mit dieser Art von demokratischer Machtverteilung.
Allerdings hat sich Hans Küng (2010:271) explizit gegen eine Weltregierung in irgendeiner Form ausgesprochen: Eine Weltregierung „ist weder realistisch noch erstrebenswert. Sie wäre allzu weit entfernt von der Welt-Bürgergesellschaft und demokratisch auch kaum legitimierbar“. Diese Position ist zwar nachvollziehbar, aber sie ist vom Weltethosgedanken her weder überzeugend noch plausibel. Dass die von der UNO eingesetzte Kommission für Weltordnungspolitik (The Commission on Global Governance) sich nicht für eine Weltregierung ausspricht, hat wohl eher mit der Rücksicht auf die nationalstaatlichen Interessen der grossen Mächte zu tun als mit einer grundsätzlichen Ablehnung. Und darüber, ob ein demokratischer Weltstaat realistisch ist oder nicht, kann man streiten. Vor Ende des Zweiten Weltkriegs erschien auch eine UNO kaum als realistisch, und vor 1989 ebenso die Überwindung des Kalten Kriegs.
Küng befindet sich mit seiner Forderung nach einem globalen politischen Grundkonsens in guter Gesellschaft. So hatte bereits Papst Benedikt XVI. in seiner Enzyklika Caritas in Veritate (CV) vom 29.6.2009 „das Vorhandensein einer echten politischen Weltautorität“ (CV 2009:67 18; vgl. auch Herrmann 2017:236) gefordert. Und Johannes XXIII. hatte schon 46 Jahre zuvor in seiner Enzyklika Pacem in Terris (PT 71) festgestellt: „Da aber heute das allgemeine Wohl der Völker Fragen aufwirft, die alle Nationen der Welt betreffen, und da diese Fragen nur durch eine politische Gewalt geklärt werden können, deren Macht und Organisation und deren Mittel einen dementsprechenden Umfang haben müssen, deren Wirksamkeit sich somit über den ganzen Erdkreis erstrecken muss, so folgt um der sittlichen Ordnung willen zwingend, dass eine universale politische Gewalt eingesetzt werden muss“. Und Papst Franziskus nahm 2015 in der Enzyklika Laudato Si die Forderung nach einer politischen Weltautorität wieder auf und bekräftigte sie (vgl. LS 175).
Gleichzeitig muss man sich fragen, ob Küngs (2010:276) Vorschlag, die Nationalstaaten sollten zusammen mit internationalen Organisationen wie die WTO oder IWF eine Weltordnungspolitik verwirklichen, nicht deutlich hinter den Anforderungen unserer Zeit zurückbleibt. Global Governance ist und bleibt ein freiwilliges Zusammenwirken nationalstaatlicher, privater und internationaler Akteure – und sobald die Interessen eines wichtigen Players tangiert werden, erweist sich die Global Governance zumeist als heisse Luft 19.
Deshalb braucht es – wie Heimbach-Steins (2016:93) zu Recht bemerkte – eine globale Ordnung nicht nur von Eigentums- und Nutzungsrechten, sondern auch des Zugangs aller zu den lebensnotwendigen Ressourcen. Das gilt auch für soziale Leistungen, etwa in Form eines weltweiten garantierten Rechts auf ein existenzsicherndes Grundeinkommen.
In Anlehnung an Peter Singer hat Heather Widdows (2011:154) die These vertreten, dass Nähe und Distanz moralisch nicht signifikant sind und die Zahl der Menschen, welche in einer bestimmten Situation Hilfe leisten können, für die ethisch-moralische Bewertung einer Hilfeleistung irrelevant ist. Das bedeutet: Die Bewertung meines Verhaltens ist nicht davon abhängig zu machen, wie viele andere Menschen an meiner Stelle helfen könn(t)en oder nicht. Eine solche Haltung hat gravierende Folgen: Eine Verpflichtung zu sozialer und wirtschaftlicher Hilfe ist nicht von der geografischen Nähe oder sozialen Distanz zum Hilfebedürftigen abhängig, sondern davon, ob dieser Hilfe braucht oder nicht. Anders gesagt: Jeder Mensch – egal wo er wohnt – ist zu Hilfe und Solidarität verpflichtet, aber diese Hilfe muss auch koordiniert werden, sonst bleibt sie chaotisch, impressionistisch und punktuell. Und das kann letztlich nur eine demokratische Weltregierung leisten.
Auch aus religiöser Sicht ist es mehr als berechtigt, den Aufbau eines demokratischen Weltstaates als Postulat zu formulieren. So folgerte etwa Frank Crüsemann (2003:143) mit Blick auf die Friedensthematik: „Wie Frieden und Recht, Frieden und Gerechtigkeit zusammengehören, kann nicht ein für alle Mal entschieden werden, so lange nicht, wie die Welt nicht wie ein wirklicher Rechtsstaat organisiert ist, also die Macht nicht dem Recht unterworfen ist, demokratisch und kontrollierbar, durchsichtig und überprüfbar “.
Eng verbunden mit der Frage eines Weltstaates – und eine Voraussetzung dazu – ist die Forderung nach einer „globalen Staatsbürgerschaft“ („global citizenship“). Robin S. Seelan (2015:141) bezeichnet eine solche in der heutigen Zeit als „unvermeidbar und unerlässlich“. Sie ist verbunden mit einer Orientierung und einem Weltbild, welche die gesamte Menschheit im Blick haben. Zu Recht hat Seelan (2015:141) darauf hingewiesen, dass viele Religionen versucht haben, die Grundidee der Gemeinsamkeit aller Menschen, der Universalität und der Brüderlichkeit unter den Völkern ins Zentrum ihrer Heilsordnung zu stellen. Aber gerade auch in religiösen Kontexten wurde immer wieder versucht, eine Grenze zwischen den eigenen Gläubigen (Ingroup) und den übrigen Menschen (Outgroup) zu ziehen. Aber beides geht nicht gleichzeitig.
An-Na’im (2011:22) hat in seinem Buch „Muslims and Global Justice“ darauf hingewiesen, dass die Durchsetzung der Menschenrechte und die Meinungsäusserungsfreiheit, Glaubens- und Religionsfreiheit, Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen und zu Bildung für alle Menschen unmöglich bleibt, wenn sie jeweils nur für die eigenen Bürgerinnen und Bürger eines Landes garantiert werden. Dieses Paradox könne nur aufgelöst werden, wenn es zwei sich überlappende Bereiche von Bürgerrechten gebe: nationale Bürgerrechte und Weltbürgerrechte. Gegenüber dem traditionellen, eindimensionalen nationalen Bürgerrecht brauche es eine Art abgestuftes internationales Bürgerrecht (vgl. An-Na’im 2011:22). Dabei müsse die Zivilgesellschaft lokal verwurzelt bleiben. Zivilgesellschaft und Staat müssten in einem komplementären, sich ergänzenden Verhältnis stehen.
Читать дальше