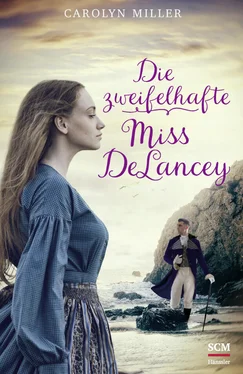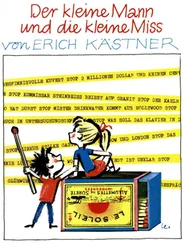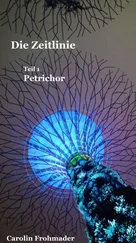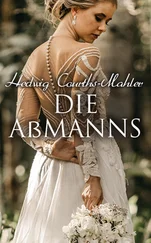Clara holte tief Luft und löste sich aus der Umarmung; dabei nahm sie einen leisen Hauch von Lavendelduft wahr. Sie strich sich glättend über das Haar und trocknete ihre Tränen, ganz rot vor Verlegenheit. »Es tut mir leid!«
»Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Mir würde es in Ihrer Situation genauso gehen.«
Ihre Freundlichkeit legte sich um Clara wie eine weiche Decke und ließ sie sagen: »Ich … ich fühle mich so verloren, als wüsste ich gar nicht mehr, wer ich bin.«
Beide schwiegen. »Wer ist Clara?«
»Verzeihung?«
»Wer sind Sie? Wirklich?«
Clara lehnte sich zurück und dachte nach. Wer war sie? Die Tochter eines Viscounts? Ein Mensch, dessen Hauptinteresse der Erwerb neuer Kleider war? Vergnügungen? War sie in einem Traum verloren, der nie Wirklichkeit werden würde? Der Graf war weitergegangen. War es nicht Zeit, dass sie dasselbe tat?
»Wollen Sie wirklich zulassen, dass der Korb, den Sie von einem Mann bekommen haben, Ihr ganzes weiteres Leben bestimmt?«
Clara lachte rau. »Ich glaube, es ist eher die Summe aller Männer, die mir einen Korb gegeben haben.«
»Gott gibt Ihnen keinen Korb, Clara.«
Die Worte legten sich um ihr Herz, das zarte Ziehen, das sie in den letzten Tagen gespürt hatte, wurde stärker. »Ich weiß nicht …«
»Aber ich. Ich weiß, dass Gott Sie liebt und dass seine Pläne für Sie gut sind.«
Matildas mit so großer Sicherheit gegebene Antwort machte ihr ein ganz klein wenig Hoffnung. Nahm Gott sie wirklich wahr? War es möglich, dass dem Schöpfer des Universums etwas an ihr lag?
»Vielleicht wird es Zeit, dass Sie Gott erlauben, Sie zu heilen und Ihnen zu zeigen, wer Sie in seinen Augen sind.«
Clara schluckte. »Vielleicht.«
»Habe ich nicht Klavierspiel gehört, als ich gekommen bin?«
Sie blinzelte, der Themenwechsel überraschte sie. »Ich … äh, ja. Ich habe gespielt.«
Matilda lächelte. »Dann bin ich sicher, dass Gottes Pläne für Sie Ihr musikalisches Talent miteinbeziehen. Sie spielen wirklich gut.«
»Danke.« Sie verbiss sich einen stolzen Kommentar, nämlich dass sie früher in den vornehmsten Salons Londons gespielt und gesungen habe. Diese Zeiten waren lange vorbei.
Matilda zog die Brauen hoch, dann lächelte sie. »Könnten Sie uns nicht helfen und bei der Mission spielen? Benjie, mein Bruder, möchte den Seeleuten und Soldaten helfen, die im Krieg versehrt wurden.« In ihren Augen stand schon wieder der Schalk. »Wenn Sie spielen, werden alle ganz wild darauf sein zu kommen.«
»Oh. Ich …« Wie konnte sie nur einigermaßen höflich ablehnen? Aber, so kam es kritisch aus einer Ecke ihres Herzens, sie wollte doch gar nicht ablehnen. Sie musste weiß Gott ihr Leben ändern. Außerdem hatte sie so die Möglichkeit, endlich Matildas und Tessas angebeteten Bruder kennenzulernen. »Ich komme gern.«
»Ausgezeichnet!« Matilda erhob sich. Sie streckte die Hand aus. »Vielen Dank für alles. Und Sie wissen hoffentlich, dass ich keinem Menschen gegenüber auch nur ein Wort über Ihren Kummer verlauten lasse.«
»Das weiß ich«, sagte sie, überrascht über diese Zusicherung. Sie hatte gewusst, dass sie ihrer neuen Freundin vertrauen konnte, doch heute hatte ihre Freundschaft an Tiefe gewonnen. »Danke, dass Sie mich nicht verurteilen.«
»Ach, wissen Sie, wir alle haben Dinge, für die wir uns schämen. Und falls es Ihnen hilft, ich bin Mr McPherson erst begegnet, als die Leute bereits sicher waren, dass ich mein Leben als alte Jungfer beschließen würde. Das zeigt nur, dass gute Dinge es wert sind, auf sie zu warten.«
Claras Lächeln fiel ein wenig ironisch aus. Anscheinend wartete sie auf jemand ganz Besonderen.
Chatham Hall, Kent
»Aber George, verstehst du denn nicht? Das geht nicht! Wenn Tessa Braithwaite heiratet, ist sie für immer eine Gefangene seines Weltschmerzes.«
Sein Bruder betrachtete sich im Spiegel und zupfte an seiner soeben erst zurechtgezogenen Jacke. »Wie kann der Mann sich selbst die Schuld geben, wenn du es offensichtlich nicht tust? Das ist mir völlig unverständlich.«
Ben verbiss sich die Antwort, die er ihm im ersten Moment beinahe gegeben hätte. Und er verbiss sich auch die zweite Antwort. Es gab vieles, was seinem stutzerhaften Bruder unverständlich war, insbesondere alles, was mit Selbstaufopferung zu tun hatte. Er trat an das Fenster, das auf den Garten hinausging, der so grün war wie die Bäume Ceylons in seiner Erinnerung. Was den Schiffbruch, an dem er sich die Schuld gab, betraf, so war er damit bereits vor Monaten ins Reine gekommen. Der Schiffbruch der Ansdruther war eine unvorhersehbare Tragödie gewesen, die zwar möglicherweise durch den Einsatz von Braithwaites kostbarem Chronometer hätte vermieden werden können, aber der Wind und die Wellen waren so stark gewesen, dass sie höchstwahrscheinlich auch dann den Verlust von Menschenleben zu beklagen gehabt hätten, wenn sie nicht gegen das Riff getrieben wären.
»Verzeihung, Sir?«
Bei der Frage des Dieners und Georges gemurmelter Antwort verschwand der beruhigende Anblick ordentlicher Baum- und Gebüschreihen vor seinen Augen. An seine Stelle traten die Erinnerungen an jene schicksalhafte Fahrt. Er hatte Soldaten und ihre Angehörigen zurück nach England bringen sollen und war an der Südspitze Afrikas von einem plötzlichen Wetterumschwung überrascht worden. Völlig unvermittelt hatte sich der Himmel mit dichten, düsteren Wolken überzogen. Der Wind schwoll zum Sturm an, so gewaltig, dass kräftige Männer von den Füßen geweht wurden. Ein Mast brach mit einem entsetzlichen Krachen. Dann das grauenhafte Geräusch, das kein Seemann je hören wollte, als das Schiff an dem Riff entlangschrammte. An jenem Tag war seine Karriere, seine ganze Welt mit einem ohrenbetäubenden Getöse eingestürzt.
Am Himmel erschienen silberne Streifen, die ihre Finger nach ihm auszustrecken schienen. Um ihn herum erklangen die Schreie der Menschen, nur um sogleich vom gefräßigen Sturm verschlungen zu werden. Das Meer – so lange sein Freund – war zum tödlichen Feind geworden.
Die Tochter des Admirals, Miss Marianne York, kam an Deck; ihre gewöhnliche eigensinnige Unbekümmertheit verstummte angesichts der Sorge, die hier oben herrschte.
»Miss York, ich muss Sie leider bitten, wieder nach unten zu gehen.«
»Ich habe schon viele Stürme erlebt, Kapitän Kemsley. Mein Vater …«
»Nicht auf meinem Schiff.« Leichtsinniges, dummes Ding. »Bitte gehen Sie unter Deck.«
»Aber …«
»Runter! Sofort!«
Sie zog einen Flunsch, machte auf dem Absatz kehrt und verschwand, sodass er sich wieder auf die stürmische See konzentrieren konnte.
Gott, hilf uns! Die Angst zerrte an ihm. Er stemmte sich gegen den Wind, versuchte mit aller Kraft, das Steuer zu bewegen. Wenn er es nur eine Winzigkeit drehen konnte, hatten sie eine Chance, eine kleine Chance, aber immerhin eine Chance. Doch die Wellen trieben sie ans Ufer.
»Kapitän!«
Ben strengte sich an, die Worte seines Leutnants zu verstehen, die vom Sturm verschluckt wurden. »Was?«
»Der Laderaum!«, brüllte Burford. »Er läuft voll! Wir müssen von Bord!«
Gott, was soll ich nur tun?
Er blickte sich auf Deck um. Seine Männer arbeiteten fieberhaft, doch in ihren starren Gesichtern war bereits die schreckliche Wahrheit zu lesen. Er hätte sein letztes Geld darauf verwettet, dass keiner von ihnen – er eingeschlossen – je eine so furchtbare Nacht erlebt hatte. Lancaster mochte noch so viel von schwersten Stürmen in der Karibik erzählt haben: Auch in seinem Gesicht stand nur noch die nackte Angst.
Ben presste die Lippen zusammen, kämpfte gegen seine eigene Todesangst, um die Stimme dessen zu hören, der ihn schon so oft gerettet hatte. Und ihre Antwort kam und mit ihr ein Stück Frieden. »Gehen Sie.«
Читать дальше