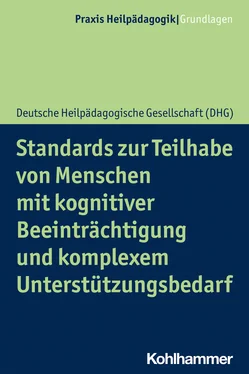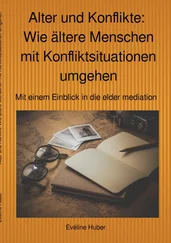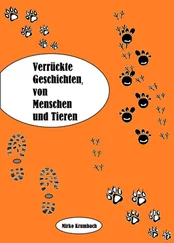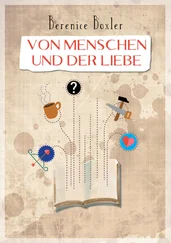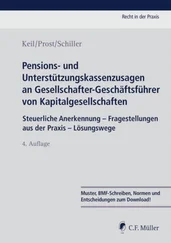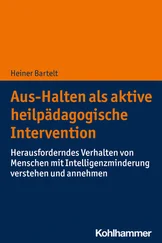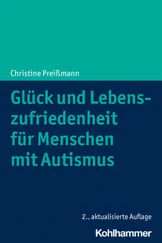Frehe, H. (1999): Persönliche Assistenz – eine neue Qualität ambulanter Hilfen. In: W. Jantzen, W. Lanwer-Koppelin & K. Schulz (Hrsg.): Qualitätssicherung und Deinstitutionalisierung. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Berlin: Edition Marhold, S. 271–284.
Seifert, M. (2006): Lebensqualität von erwachsenen Menschen mit schweren Behinderungen. Forschungsmethodischer Zugang und Forschungsergebnisse. In: Zeitschrift für Inklusion 1 (2). Online verfügbar unter: www.inklusion-online.net, Zugriff am 28.06.2020.
Seifert, M. (2009): Selbstbestimmung und Fürsorge im Hinblick auf Menschen mit besonderen Bedarfen. In: Teilhabe, 48 (3), S. 122–128.
Personenzentrierung ist kein eigenständiger Leitbegriff. Er fokussiert die Umsetzung der Leitideen Selbstbestimmung und Teilhabe auf der Leistungsebene i. S. eines »Transmissionskonzepts«:
»Personenzentrierung dient dazu, eine Verbindung zu schaffen zwischen einer abstrakten, paradigmatischen Ebene (…) und einer konkreteren, gesetzespolitischen Ebene, auf der letztlich ausgehandelt wird, welche Veränderungsbedarfe und Umsteuerungsmaßnahmen als notwendig erscheinen. Die Veränderungsbedarfe werden insbesondre von der Oppositionsfigur Institutionszentrierung abgeleitet: Die Reform soll den einrichtungsbezogenen Charakter der Eingliederungshilfe überwinden, und diese Stoßrichtung wird als Schlüssel zur Individualisierung der Hilfen gedeutet.« 22
Mit dem Wandel von der institutionellen zur personalen Perspektive werden Leistungen der Eingliederungshilfe ausschließlich personenzentriert erbracht. Die erforderliche Unterstützung ist am individuellen Bedarf auszurichten, unabhängig von der jeweiligen Wohnform. Die Individualität von Menschen mit Behinderungen soll bei der Bedarfsermittlung, der Leistungsplanung und der Leistungsgestaltung stärker als bisher Berücksichtigung finden. Das heißt konkret: Die Unterstützungsarrangements sollen den persönlichen Vorstellungen von einem »guten Leben« möglichst nahe kommen. Sie sollen mit dem Betroffenen gemeinsam – partizipativ – entwickelt werden. Es geht also nicht länger darum, in welches Angebot eine Person »passt«, sondern darum, wie eigene Lebensentwürfe umgesetzt werden können. In der Begründung zur Aufnahme des Begriffs Assistenz im BTHG wird das veränderte Verständnis von professioneller Hilfe gegenüber förderzentrierten Ansätzen der Betreuung ausdrücklich hervorgehoben. 23 Personenzentrierung ist damit nicht nur ein Handlungskonzept, sondern auch ein Haltungskonzept.
Bei Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf, die ihre Wünsche und Interessen nur bedingt selbst artikulieren können, bedeutet Personenzentrierung, einen Perspektivenwechsel einzunehmen, sich von eigenen Vorstellungen zu verabschieden und sich auf die Ebene der Betroffenen einzulassen, um herauszufinden, was im Einzelfall für einen gelingenden Alltag bedeutsam ist. Das Konzept Lebensqualität gibt Impulse, den Blick für Bedingungsfaktoren und Handlungsansätze zu schärfen, die zum subjektiven Wohlbefinden beitragen. 24
Notwendige Voraussetzung ist eine Haltung, die Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf nicht primär in ihren Defiziten wahrnimmt, sondern als Menschen wie du und ich. Wichtige Fragen sind: 25
• Schauen wir zuerst auf das Abweichende von der Norm – oder auf das Gemeinsame von Menschen mit und ohne Behinderung?
• Beachten wir bei unserem Gegenüber primär die Beeinträchtigungen – oder die Entwicklungspotenziale?
• Sind wir auf die persönlichen Eigenheiten der Menschen mit schweren Behinderungen fixiert oder nehmen wir sie im Kontext ihrer Lebenswelt wahr?
• Sehen wir ihre gegenwärtigen Lebensbedingungen als gegeben oder entwickeln wir einen kritischen Blick für notwendige Veränderungen?
• Betrachten wir Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und komplexem Unterstützungsbedarf als einen Personenkreis, der wegen seiner »Besonderheiten« der Betreuung in »besonderen Räumen« bedarf – oder als Bürger*innen der Gesellschaft mit dem Recht auf Teilhabe und die dazu notwendige Unterstützung?
Das BTHG stärkt die Position der Leistungsberechtigten. Die Umsetzung der persönlichen Vorstellungen soll durch die Abschaffung der Leistungskategorien »ambulant«, »teilstationär« und »stationär« erleichtert werden. Individuell gestaltetes Wohnen kann nun auch für viele Menschen, die bislang auf stationäre Angebote angewiesen waren, Wirklichkeit werden.
Für Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf sind infolge des weiterhin bestehenden Mehrkostenvorbehalts (§ 104 Abs. 2 SGB IX) individuelle Unterstützungsarrangements außerhalb von Heimstrukturen jedoch nach wie vor die Ausnahme. Damit ist das Sortieren von Menschen nach dem Grad ihrer Selbstständigkeit weiterhin Realität – ein Widerspruch zu den menschenrechtlichen Vorgaben der UN-BRK (Art. 19) für eine personbezogene Unterstützung an selbstgewählten Wohnorten und Wohnformen.
Auch eine gemeinsame Leistungserbringung gegen den Willen der Menschen mit Behinderung widerspricht der Personenzentrierung. Sie fördert institutionalisierte Wohnformen und ist gerade bei komplexem Unterstützungsbedarf angesichts sehr individueller Lebens- und Problemlagen weder angemessen noch zumutbar. 26
Schäfers, M. (2017): Personenzentrierung als sozialpolitische Programmformel. Zum Diskurs der Eingliederungshilfereform. In: G. Wansing & M. Windisch (Hrsg.), Selbstbestimmte Lebensführung und Teilhabe. Behinderung und Unterstützung im Gemeinwesen. Stuttgart: Kohlhammer, S. 33–48.
Seifert, M. (2009): Selbstbestimmung und Fürsorge im Hinblick auf Menschen mit besonderen Bedarfen. In: Teilhabe, 48 (3), S. 122–128.
2.4 Sozialraumorientierung
Der Begriff Sozialraum hat eine mehrdimensionale Bedeutung. Als subjektive Kategorie bezieht er sich primär auf die individuellen Beziehungsnetzwerke, unabhängig vom jeweiligen Ort. Als geografischer Raum fokussiert er das nähere und weitere Wohnumfeld, den Stadtteil, das Dorf oder die Gemeinde. Als Verwaltungskategorie ist er für kommunale Planungen relevant.
Für die Zielsetzungen der UN-BRK sind die genannten Dimensionen gleichermaßen von Bedeutung. Die UN-BRK will einen »Beitrag zur Beseitigung der tiefgreifenden sozialen Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen leisten und ihre Teilhabe am bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben auf der Grundlage der Chancengleichheit fördern« (Präambel lit. y). Damit werden Wege eröffnet, die die »Gleichzeitigkeit von Drinnen und Draußen« überwinden könnten, die das Alltagserleben von Menschen mit Behinderungen prägt, in allen Lebensphasen und Lebensbereichen. 27 Gleichzeitigkeit von Drinnen und Draußen bedeutet, »Teil einer Gesellschaft zu sein und dennoch die Erfahrung machen zu müssen, nicht dazuzugehören« 28 – ein Sachverhalt, der nicht allein den gesellschaftlichen Verhältnissen geschuldet ist, sondern auch als ein Produkt des Systems Behindertenhilfe interpretiert werden kann, das – in guter Absicht – in allen Bereichen für Menschen mit Behinderungen spezielle Angebote entwickelt hat. Dieser Tatbestand kann nur durch die Entwicklung einer inklusiven (Bürger-)Gesellschaft aufgelöst werden, in der die Verantwortung für soziale Ausgrenzungsprozesse und ihre Bewältigung zurückgegeben wird an die gesellschaftlichen Institutionen und Akteure. 29
In diesem Kontext spielt das Fachkonzept Sozialraumorientierung eine zentrale Rolle. Es hat seine Wurzeln in der Gemeinwesenarbeit der 1970/1980er Jahre, ist in der Jugendhilfe, in der sozialen Stadtentwicklung und in Quartierskonzepten der Altenhilfe fest etabliert und wird zunehmend auch in der Behindertenhilfe rezipiert. Sozialraumorientierte Arbeit will dazu beitragen, Lebensbedingungen so zu gestalten, »dass Menschen dort entsprechend ihren Bedürfnissen zufrieden(er) leben können«. 30 Ausgehend vom Willen des Einzelnen, der Stärkung seiner Eigeninitiative und dem Einbezug seiner persönlichen und sozialen Ressourcen werden durch zielgruppen- und bereichsübergreifende Kooperation und Vernetzung mit lokalen Akteur*innen Ressourcen im Stadtviertel oder der Gemeinde erschlossen, die die Teilhabechancen stärken. Auf der Basis der genannten Prinzipien haben Früchtel & Budde die Handlungsfelder sozialraumorientierter Arbeit in einem mehrdimensionalen Modell beschrieben (SONI-Modell). 31 Es konkretisiert sozialraumbezogene Handlungsfelder in der alltäglichen Lebenswelt (Bezug: Individuum und Gemeinwesen) und auf Systemebene (Bezug: Organisation und Kommunalpolitik). 32
Читать дальше