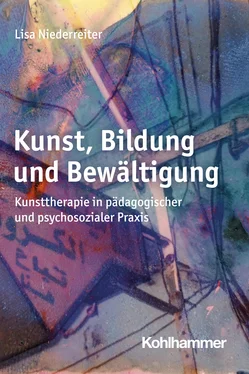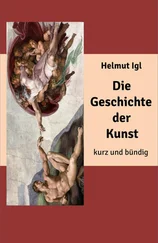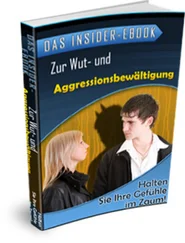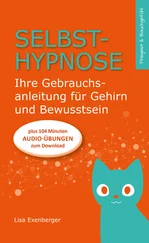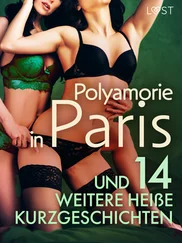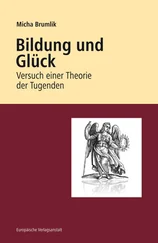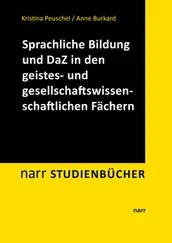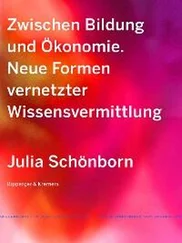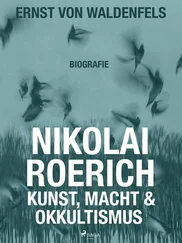Lisa Niederreiter - Kunst, Bildung und Bewältigung
Здесь есть возможность читать онлайн «Lisa Niederreiter - Kunst, Bildung und Bewältigung» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Kunst, Bildung und Bewältigung
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kunst, Bildung und Bewältigung: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Kunst, Bildung und Bewältigung»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Kunst, Bildung und Bewältigung — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Kunst, Bildung und Bewältigung», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Über unterschiedliche Testverfahren kann die kindliche Mentalisierungsfähigkeit mittlerweile gut eingeschätzt werden, bezeichnend sind dabei Studienergebnisse, welche den engen Zusammenhang zwischen sicheren Bindungserfahrungen und Mentalisierungsreife bei Kindern belegen (vgl. Fonagy, a. a. O., 907). Im Gegensatz dazu zeigen sich bei Kindern mit desorganisierten Bindungserfahrungen, beispielsweise früh traumatisierten oder vernachlässigten Kindern, mangelnde Mentalisierungs- und Symbolisierungskompetenzen. Diese werden im »Agieren-Müssen« von Affekten und Bedürfnissen sichtbar, in einem wenig bewussten, stark verhaltensorientierten In-Szene-Setzen von Gefühlen und Impulsen mit anderen. Das bedeutet, das Kind verfügt nicht ausreichend über eine mentale Repräsentation von Gefühlen, Wünschen, Bedürfnissen und Affekten, sie können schwer vorgestellt, gedacht und (verbal) geäußert werden. Sie sind nicht im sprachlich-symbolischen Gedächtnis, sondern im unbewussten, körperlich/prozeduralen abgespeichert (vgl. Staehle, a. a. O., 126). Daher werden sie ausagiert, was in unserem fachlichen Zusammenhang wiederum die große Bedeutung szenischer, köperorientiert-performativer und nonverbal-sinnlicher und bildhaft symbolisierender Verfahren als Ausdrucks-, aber auch als Interventionsform für Adressat*innen mit geschwächten Mentalisierungsfähigkeiten auf den Plan ruft. Sinnlich-ästhetische Erlebnis-, Kommunikations- und Ausdrucksformen unterstützen die mentalen Wahrnehmungen und Erkundungen eigener emotional und affektiv getönter Zustände und Bedürfnisse im Sinne eines möglichen Erweiterns, Nachholens und »Nachlernens« von mangelnden Fähigkeiten zu mentalisieren.
Zwei Modi bzw. Niveaus innerhalb der Mentalisierung spezifizieren dementsprechende Kompetenzen im Kindesalter, stellen gleichzeitig Bezüge zum symbolisierenden Spiel in seiner Funktion für psychische und mentale Reifungsprozesse her und begründen daher den Einsatz des Spiels als wichtige Interventionsform. Der nach Fonagy und Target entwicklungspsychologisch früher anzusiedelnde Äquivalenzmodus (bis ca. 20. Lebensmonat) entspricht einem Gleichsetzen von innerem Erleben und äußerer Welt (vgl. Schultz-Venrath, 2013, 98); das kann in bestimmten Situationen oder im Zuge psychischer Erkrankungen auch in späteren Lebensaltern vorkommen. Beispiele sind ein Nichtunterscheidenkönnen von sich wertlos fühlen und wertlos sein, oder die Wahrnehmungsverzerrung etwa bei Stalker*innen, die sich in keinster Weise vorstellen können, das begehrte Gegenüber sei nicht im selben Maße an einem nahen Kontakt interessiert wie sie selbst (vgl. ebd., 99). Dass »ein Sich selbst und die Welt im Äquivalenzmodus verhandeln« zu Rigiditäten, Verkennungen der Realität/des Anderen und damit zu Problemen im Umgang mit sich selbst und anderen führt, wird nachvollziehbar. Im entwicklungspsychologisch später folgenden sog. »Als-ob-Modus« vermag das Kind sich nun mit viel Energie meist über das Spiel in Anlehnung an Objekte der Realität ein befriedigendes Szenario zu erschaffen und darin zu handeln. Es weiß dabei sehr wohl, dass das Spiel nicht Wirklichkeit ist. Es ist jedoch viel mehr als Phantasie, ihm kommt ein Charakter symbolischer Realität zu, es steht für Wirkliches, ohne wirklich zu sein. Das Spiel dient dazu, Erlebtes, Gewünschtes, Gefühltes, Gewolltes von sich an die Welt zu verhandeln, auszuprobieren, sich darin kennenzulernen und so größeres Bewusstsein zu erlangen.
Im engeren Sinne ist der Als-ob-Modus auch als Befähigung zu verstehen, gefährliche oder schädliche Affekte in gespielte (vorgetäuschte) Gesten oder Handlungen zu verwandeln (so tun als ob: beispielsweise den besten Freund, auf den man gerade wütend ist, mit ausgestrecktem Gewehr-Arm und entsprechenden Geräuschen scheinbar zu erschießen) und sie in dieser Symbolhandlung loszuwerden (ohne den Freund wirklich zu vernichten). »Auf diese Weise hat das Als-ob-Prinzip zwei Schlüssel-Aspekte: die ikonische Repräsentation (Imitation) von Objekten, Handlungen und Ereignissen und das Markieren des Vorgebens (Täuschens), […]« (ebd., 101). Natürlich müssen die Als-Ob-Handlungen vom Gegenüber in ihrem pseudo-wirklichen Charakter auch verstanden werden, was seinerseits Mentalisierungsfähigkeiten voraussetzt. Im Alter von vier bis fünf Jahren gelingt im idealen Falle eine Integration des Äquivalenz- und Als-ob-Modus und das Kind erreicht so ein neues Reflexionsniveau. Auf Dornes verweisend umreißt das Gerspach so: »Das Kind kann nun die vermuteten mentalen Zustände selbst wieder zum Gegenstand des (Nach-)Denkens machen und auch über den Wahrheitsgehalt seiner eigenen Phantasien und Ängste nachsinnen« (Gerspach, a. a. O., 97).
2.4.2 Symbol, Repräsentanz und Mentalisierung
Der vorangegangene Abschnitt zu den Binnen-Vorgängen der Mentalisierung dient einerseits der theoretischen Grundlagenbildung zu tiefenpsychologischem Wissen im Kontext von Subjektbildung in Abhängigkeit von Bindungserfahrung und geistiger Entwicklung, wie sie für Pädagogik, psychosoziale Praxis und Therapie gleichermaßen bedeutsam sind. Zum anderen klingt hier mehrfach die später noch auszuarbeitende Funktion des Symbols auch im Kontext der ästhetischen Wahrnehmung und des Ausdruckshandelns an. Eine zentrale, tiefenpsychologisch inspirierte Theorie hierzu ist Donald Winnicotts Forschung zum sog. Übergangsobjekt als erster kreativer Akt in der menschlichen Entwicklung (vgl. Winnicott in Limberg, 1998, 49), das in Kapitel 3 (  Kap. 3) zu den Kernelementen künstlerischer Tätigkeit vorgestellt wird. Welch große Rolle der ästhetische Gegenstand als Manifestation von Symbolisierung spielt, leuchtet sicherlich ein. Vorauszuschicken ist im Anschluss an die Erarbeitung des Mentalisierens ein kleines Summary zum Symbolbegriff, der sich einerseits multidisziplinär breit aufgefächert darstellt und was die Tiefenpsychologie betrifft, auch innerhalb einer wissenschaftlichen Theoriebildung so überfrachtet scheint, dass eine umfassende Klärung des Begriffs für diese Publikation lediglich ausschnitthaft möglich ist. Mit Laurie Wilson nutze ich das Beres’sche, ichpsychologisch codierte Symbolverständnis als »Repräsentanz« (Wilson, 1991, 64) von etwas und nicht als deren Ersatz (vgl. ebd.). »Die Fähigkeit, ein abwesendes Objekt zu evozieren, setzt eine Qualität des kognitiven Funktionierens voraus, die es dem Schöpfer eines Symbols erlaubt, ein Bild in seinem Geist wahrzunehmen und festzuhalten« (ebd.). Diese Fähigkeit zu psychischer Repräsentanz (beispielsweise nach Nähe zu einem Objekt) ist nicht angeboren und wie die Mentalisierung Teil einer bedeutsamen Reifung im Kleinkindalter. Sie steht als dritte Stufe der frühen sensorischen Ebene als neurophysiologisches, prärezeptives Phänomen (Stufe eins), auf die sodann die Koppelung von sensorischen Reizen mit Inhalten (Stufe zwei) folgt, welche an Reaktionen ablesbar werden (vgl. ebd., 65). Die Herausbildung zu psychischen Repräsentanzen braucht dagegen keinen direkten Reiz von außen mehr, insofern ist sie »reifer«. Sie braucht vielleicht einen Anlass, aber keinen Wahrnehmungsreiz, und stellt »die Bausteine für andere komplexere psychische Repräsentanzen: für Bilder, Phantasien, Gedanken, Begriffe, Träume, Halluzinationen, Symptome und Sprache« (ebd., 65) zur Verfügung. Es sind empfundene Impulse, Bedürfnisse, Wünsche, die in der Repräsentanz/Symbolisierung mental vorstellbar werden, vielschichtiger, vieldeutiger, auch verunklärter als der in Worte fassbare Gedanke dazu. Darin birgt die Symbolisierung im Gegensatz zum Wort ihr herausragendes Potential. Rubin zitiert für diesen Weg des Affekts zur symbolisierenden Repräsentanz Gendlin: »Gefühl ohne Symbolisierung ist blind; Symbolisierung ohne Gefühl ist leer« (Gendlin zit. in Rubin, 1993, 331). Und weiter mit Rubin meint die symbolisierte oder auch mentalisierte Affekt- und Gefühlsrepräsentanz die prominenteste Form wirklichen Wissens als »perzeptuell-emotionale Erkenntnis« (ebd.), die selbst das denkbar macht, was noch vage oder unbeschreiblich erfahren wird und mehrdeutig, eventuell auch widersprüchlich oder paradox erlebt wird. So viel zum Vorgang des Symbolisierens in seiner Bedeutung für die psychische und geistige Entwicklung des Kindes in seiner Nähe zum Konzept des Mentalisierens. Ein weiterführendes Nachdenken über die Aufgabe des Symbols in der Kunst bzw. im künstlerischen Tun erfolgt im nächsten Kapitel. Um die allgemeinen Überlegungen zu den Grundlagen erzieherischen versus therapeutischen Handelns abzuschließen, kann ergänzt werden, dass selbst für den schulischen Unterricht und die Rolle der*des Lehrenden umfängliche Konzepte für einen mentalisierungsbasierten Unterricht zur Eröffnung von Räumen für Gefühls-Symbolisierungen auch in der Gruppe vorliegen (vgl. Hirblinger, 2011). Insofern erfolgt hier nochmals ein Plädoyer dafür, Theoriebildungen aus der Psychoanalyse nicht als spekulative und oder unverhältnismäßige Therapeutisierung von Bildungsprozessen abzutun, sondern sie in ihrem Potential eines Verstehenszuwaches menschlicher Verhaltens- und Ausdrucksweisen aufzunehmen. Im Folgenden wird dies in Bezug auf die Ebene der Interventionen noch um weitere Aspekte aus der psychoanalytischen Pädagogik ergänzt.
Kap. 3) zu den Kernelementen künstlerischer Tätigkeit vorgestellt wird. Welch große Rolle der ästhetische Gegenstand als Manifestation von Symbolisierung spielt, leuchtet sicherlich ein. Vorauszuschicken ist im Anschluss an die Erarbeitung des Mentalisierens ein kleines Summary zum Symbolbegriff, der sich einerseits multidisziplinär breit aufgefächert darstellt und was die Tiefenpsychologie betrifft, auch innerhalb einer wissenschaftlichen Theoriebildung so überfrachtet scheint, dass eine umfassende Klärung des Begriffs für diese Publikation lediglich ausschnitthaft möglich ist. Mit Laurie Wilson nutze ich das Beres’sche, ichpsychologisch codierte Symbolverständnis als »Repräsentanz« (Wilson, 1991, 64) von etwas und nicht als deren Ersatz (vgl. ebd.). »Die Fähigkeit, ein abwesendes Objekt zu evozieren, setzt eine Qualität des kognitiven Funktionierens voraus, die es dem Schöpfer eines Symbols erlaubt, ein Bild in seinem Geist wahrzunehmen und festzuhalten« (ebd.). Diese Fähigkeit zu psychischer Repräsentanz (beispielsweise nach Nähe zu einem Objekt) ist nicht angeboren und wie die Mentalisierung Teil einer bedeutsamen Reifung im Kleinkindalter. Sie steht als dritte Stufe der frühen sensorischen Ebene als neurophysiologisches, prärezeptives Phänomen (Stufe eins), auf die sodann die Koppelung von sensorischen Reizen mit Inhalten (Stufe zwei) folgt, welche an Reaktionen ablesbar werden (vgl. ebd., 65). Die Herausbildung zu psychischen Repräsentanzen braucht dagegen keinen direkten Reiz von außen mehr, insofern ist sie »reifer«. Sie braucht vielleicht einen Anlass, aber keinen Wahrnehmungsreiz, und stellt »die Bausteine für andere komplexere psychische Repräsentanzen: für Bilder, Phantasien, Gedanken, Begriffe, Träume, Halluzinationen, Symptome und Sprache« (ebd., 65) zur Verfügung. Es sind empfundene Impulse, Bedürfnisse, Wünsche, die in der Repräsentanz/Symbolisierung mental vorstellbar werden, vielschichtiger, vieldeutiger, auch verunklärter als der in Worte fassbare Gedanke dazu. Darin birgt die Symbolisierung im Gegensatz zum Wort ihr herausragendes Potential. Rubin zitiert für diesen Weg des Affekts zur symbolisierenden Repräsentanz Gendlin: »Gefühl ohne Symbolisierung ist blind; Symbolisierung ohne Gefühl ist leer« (Gendlin zit. in Rubin, 1993, 331). Und weiter mit Rubin meint die symbolisierte oder auch mentalisierte Affekt- und Gefühlsrepräsentanz die prominenteste Form wirklichen Wissens als »perzeptuell-emotionale Erkenntnis« (ebd.), die selbst das denkbar macht, was noch vage oder unbeschreiblich erfahren wird und mehrdeutig, eventuell auch widersprüchlich oder paradox erlebt wird. So viel zum Vorgang des Symbolisierens in seiner Bedeutung für die psychische und geistige Entwicklung des Kindes in seiner Nähe zum Konzept des Mentalisierens. Ein weiterführendes Nachdenken über die Aufgabe des Symbols in der Kunst bzw. im künstlerischen Tun erfolgt im nächsten Kapitel. Um die allgemeinen Überlegungen zu den Grundlagen erzieherischen versus therapeutischen Handelns abzuschließen, kann ergänzt werden, dass selbst für den schulischen Unterricht und die Rolle der*des Lehrenden umfängliche Konzepte für einen mentalisierungsbasierten Unterricht zur Eröffnung von Räumen für Gefühls-Symbolisierungen auch in der Gruppe vorliegen (vgl. Hirblinger, 2011). Insofern erfolgt hier nochmals ein Plädoyer dafür, Theoriebildungen aus der Psychoanalyse nicht als spekulative und oder unverhältnismäßige Therapeutisierung von Bildungsprozessen abzutun, sondern sie in ihrem Potential eines Verstehenszuwaches menschlicher Verhaltens- und Ausdrucksweisen aufzunehmen. Im Folgenden wird dies in Bezug auf die Ebene der Interventionen noch um weitere Aspekte aus der psychoanalytischen Pädagogik ergänzt.
Интервал:
Закладка:
Похожие книги на «Kunst, Bildung und Bewältigung»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Kunst, Bildung und Bewältigung» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Kunst, Bildung und Bewältigung» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.