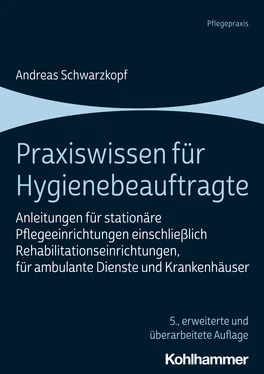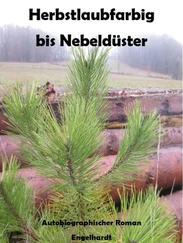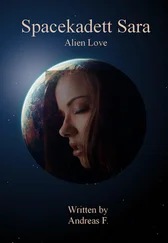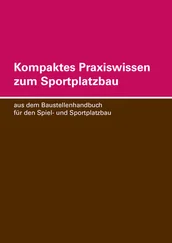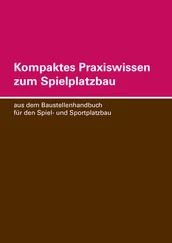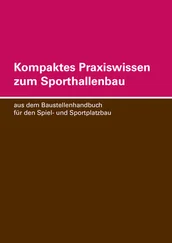An dieser Stelle sei allen gedankt, die zur Entstehung des Buches beigetragen haben. Neben der Hygienefachkraft Frau Barbara Dippert und Herrn Jürgen Klaffke, Geschäftsführer von atb – Die Berater GmbH, Stuttgart und Schwerin, dem ich das Kapitel 6.8 verdanke, sind dies die Teilnehmer der Hygieneakademie Bad Kissingen, Mitglieder des Arbeitskreises Hygienefachkräfte Mittelfranken, Mitarbeiter des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Gesundheit und Verbraucherschutz, Repräsentanten von Heimaufsicht, MDK und Gesundheitsamt, meine Sekretärin Frau Anni Wehner und Frau Sabine Mann vom Kohlhammer Verlag. Vor allem aber danke ich meiner Frau, Claudia Schwarzkopf, die Korrektur gelesen hat, und den Kindern für ihre Geduld beim Erstellen dieses Buches.
Großenbrach, im Sommer 2003
PD Dr. med. habil. Andreas Schwarzkopf
1 Vorwort zur 5. Auflage
2 Vorwort zur 1. Auflage
3 Teil 1: Hygienebeauftragter – Stellenbeschreibung
4 1 Hygienebeauftragter – Status, Ausbildung und Aufgaben
5 1.1 Status des Hygienebeauftragten
6 1.2 Aufgaben des Hygienebeauftragten
7 1.3 Selbstverständnis von Hygienebeauftragten
8 1.4 Freistellung von Hygienebeauftragten
9 1.5 Stellenbeschreibung des Hygienebeauftragten
10 1.6 Ausbildung des Hygienebeauftragten
11 1.6.1 Ausbildungsinhalte
12 Teil 2: Die Grundkenntnisse des Hygienebeauftragten
13 2 Mikrobiologie – das sollte man schon wissen
14 2.1 Der Mensch als Wirt für Mikroorganismen
15 2.2 Allgemeine Eigenschaften verschiedener Gruppen von Mikroorganismen mit Erregerbeispielen
16 2.2.1 Bakterien
17 2.2.2 Viren
18 2.2.3 Pilze
19 2.2.4 Parasiten
20 2.3 Wer ist wer in der Welt der Mikroorganismen?
21 2.3.1 Meldepflichtige Krankheiten und ihre Erreger
22 2.3.2 Wer ist wer in der Bakterienwelt?
23 2.4 Die Waffen des Körpers
24 2.5 Infektiologie – vom Kontakt zur Krankheit
25 2.5.1 Typische bakterielle Infektionen
26 2.5.2 Mögliche Verlaufsformen von Virusinfektionen
27 2.6 Schutzimpfungen
28 2.6.1 Prinzip der Impfung
29 2.6.2 Wann soll nicht geimpft werden?
30 2.6.3 Wer ist im Betrieb für den Impfschutz zuständig?
31 2.6.4 Empfohlene Schutzimpfungen für das Pflegepersonal
32 2.6.5 Empfohlene Schutzimpfungen für Bewohner
33 2.7 Von Proben für die Mikrobiologie und Befunden
34 3 Juristisches – was man als Hygienebeauftragter wissen sollte
35 3.1 Kleine Rechtskunde – vom Gesetz bis zur Empfehlung
36 3.1.1 Erläuterung der juristischen Begriffe
37 3.1.2 Weitere relevante Begriffe
38 3.1.3 Rechtsgrundlagen
39 3.2 Sozialgesetzbücher, Heimgesetz
40 3.3 Infektionsschutzgesetz
41 3.3.1 § 5 Epidemiologische Lage nationaler Tragweite
42 3.3.2 Meldepflicht bei Infektionen gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)
43 3.3.3 § 20 Masern-Impfpflicht
44 3.3.4 § 23 IfSG
45 3.3.5 §§ 33, 34, 35 IfSG
46 3.3.6 § 36 IfSG
47 3.3.7 §§ 42, 43 IfSG
48 3.4 BiostoffV und TRBA bzw. BGW-Regel 250
49 3.4.1 BiostoffV
50 3.4.2 TRBA 400
51 3.4.3 TRBA 250
52 3.5 Medizinprodukterecht
53 3.5.1 Medizinproduktegesetz (MPG)
54 3.5.2 Verordnungen
55 3.6 Lebensmittelrecht
56 3.7 Gefahrstoffverordnung
57 3.8 Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO/RKI)
58 3.9 Hygieneverordnungen, Richtlinien und Empfehlungen der Bundesländer (Stand 12/2014)
59 3.10 Ambulante Pflege und Sozialstationen
60 Teil 3: Arbeitsgrundlagen des Hygienebeauftragten
61 4 Der Hygieneplan
62 4.1 Wie soll er aussehen?
63 4.2 Woher nehmen, wenn nicht schreiben?
64 4.3 Erst mal schauen – die Ist-Erfassung
65 4.4 Grundlage der modernen Hygiene: Die Risikobewertung
66 4.4.1 Erreger
67 4.4.2 Abwehrstatus der Exponierten
68 4.4.3 Mögliche Maßnahmen
69 4.4.4 Praktikabilität
70 4.5 Arbeitsanweisungen selbst schreiben
71 4.6 Inhalte und Gliederung des Hygieneplans
72 4.7 Hygieneempfehlungen für die Pflege
73 4.7.1 Personalhygiene
74 4.7.2 Bettenaufbereitung
75 4.7.3 Injektionen und Infusionen
76 4.7.4 Wundmanagement aus hygienischer Sicht
77 4.7.5 Atemwege
78 4.7.6 Katheterismus der Harnblase
79 4.7.7 Medizinprodukteaufbereitung
80 4.7.8 Lebensmittel im Wohnbereich und auf den Stationen
81 4.7.9 Kranke oder ansteckungsverdächtige Bewohner
82 4.7.10 Meldewesen
83 4.7.11 Körperpflege
84 4.7.12 Aufbereitung von Pflegeutensilien
85 4.7.13 Fußpflege
86 4.7.14 Umgang mit Verstorbenen
87 4.8 Das Hygienekonzept des ambulanten Pflegedienstes
88 4.8.1 Inventar von Sozialstationen
89 4.8.2 Einrichtungen zum Waschen und Baden von Pflegebedürftigen
90 4.8.3 Räume zur Aufbereitung von Medizinprodukten
91 4.8.4 Hygieneplan
92 5 Empfehlungen für die Hauswirtschaft
93 5.1 Personalhygiene in der Hauswirtschaft
94 5.2 Gebäudereinigung – Organisation und Methoden
95 5.2.1 Innenreinigung, Fußböden
96 5.2.2 Reinigung von Inventar, Decken und Wänden
97 5.3 Gebäudereinigung – relevante Keime
98 5.3.1 Zimmer, Gemeinschaftsräume
99 5.3.2 Sanitärbereich
100 5.3.3 Toiletten
101 5.3.4 Durchführung der Reinigung aus hygienischer Sicht
102 5.4 Grundlagen der Desinfektion
103 5.5 Desinfektionsmittel auswählen
104 5.5.1 Desinfektionsmittellisten
105 5.5.2 Auswahlkriterien für Desinfektionsmittel
106 5.6 Wann reinigen – wann desinfizieren?
107 5.6.1 Einführung
108 5.6.2 Desinfektion – Wann?
109 5.6.3 Auswahl der Maßnahmen
110 5.7 Personalschulung zur Desinfektion
111 5.7.1 Umgang mit Desinfektionsmitteln
112 5.7.2 Wechsel des Desinfektionsmittels
113 5.8 Wäscherei
114 5.8.1 Fremdvergabe der Wäsche
115 5.8.2 Teilweise Fremdvergabe der Wäsche
116 5.8.3 Interne Wäscheaufbereitung
117 5.8.4 Wäschelogistik
118 5.9 Küche
119 5.9.1 Infektionskrankheiten aus der Küche
120 5.9.2 Hygiene und Qualitätssicherung in der Küche
121 5.10 Abfallkonzept
122 5.11 Wasserhygiene
123 5.12 Schädlinge: Befallskontrolle und Bekämpfung
124 Teil 4: Hygienebeauftragte in Aktion
125 6 Der Hygienebeauftragte vor Ort
126 6.1 Der erste Schritt – Kompetenzen abstecken
127 6.2 Bekanntgabe an die Mitarbeiter
128 6.3 Ist-Erfassung im Detail
129 6.3.1 Informationsquellen
130 6.3.2 Schriftliche Informationen
131 6.3.3 Mündliche Informationen
132 6.3.4 Inventar und Geräte
133 6.3.5 Checkliste Ist-Erfassung
134 6.4 Externe Dienstleister
135 6.5 Internes Meldewesen – wissen, was läuft
136 6.5.1 Infektionserfassung
137 6.5.2 Einführung neuer Medizinprodukte und Verfahren
138 6.6 Bildung eines Hygieneteams (Hygienekommission)
139 6.7 Herausgeben des Hygieneplans – vorläufige Erstellung und Diskussion
140 6.7.1 Einrichtungen mit größtenteils vorhandenem Hygieneplan
141 6.7.2 Einrichtungen mit vorhandenem Hygieneplan
142 6.7.3 Externe Zertifizierung der Einrichtungen
143 6.8 Hygiene und Qualitätsmanagement
144 6.8.1 Hygiene – zentrales Element der Qualitätssicherung
145 6.8.2 Die Ablauforganisation
146 6.8.3 Das Audit
147 6.8.4 Qualitätsmanagement in der Praxis
148 6.8.5 Hygiene und Wirtschaftlichkeit
149 6.8.6 Beispiel für Qualitätserfassung – der PDCA-Zyklus nach Deming
150 6.9 Etablieren und Überwachen des Hygieneplans
151 6.10 Bündelstrategie
152 7 Begehung der Einrichtung durch Hygienebeauftragte
Читать дальше