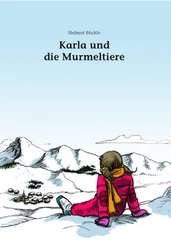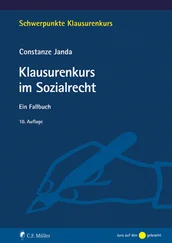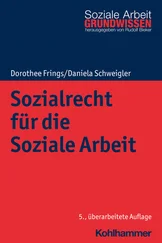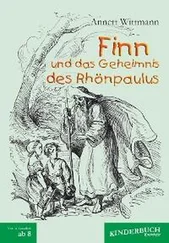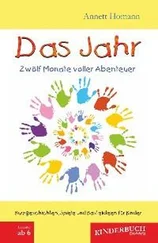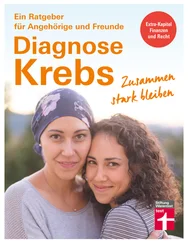Waisen bzw. Halbwaisenrente erhalten die Kinder, wenn die Eltern bzw. ein Elternteil versterben. Die Rente wird bis zum 18. Lebensjahr gezahlt. Absolvieren die Kinder eine Ausbildung, kann die Rente bis zum 27. Lebensjahr gezahlt werden.
Die Hinterbliebenen haben Anspruch aus der Rente des Versicherten. Dieser muss die Anwartschaftszeit von fünf Jahren erfüllt haben. Die Rente erfüllt dabei eine Unterhaltsersatzfunktion für die Hinterbliebenen.
2.3.2Leistungen der Krankenversicherung nach SGB V
Neben der Kostenübernahme für Behandlungen und Vorsorgeuntersuchungen erbringen die gesetzlichen Krankenkassen auch finanzielle Leistungen an ihre Versicherten.
Mitglieder von gesetzlichen Krankenversicherungen haben Anspruch auf Krankengeld, wenn sie aufgrund einer Erkrankung arbeitsunfähig sind oder stationär behandelt werden.
Bis zu sechs Wochen der Arbeitsunfähigkeit leistet der Arbeitgeber Lohnfortzahlung bei sozialversicherungspflichtiger Tätigkeit zu 100 %. Bei Erkrankung über sechs Wochen hinaus leistet die Krankenkasse Krankengeld als Entgeltersatzleistung in Höhe von 70 % des regelmäßig bezogenen Bruttoarbeitsentgelts. Die maximale Bezugsdauer beträgt 78 Wochen.
Arbeitslosengeld II-Empfänger, die nicht erwerbstätig sind oder nur einen Minijob ausüben, haben keinen Anspruch auf Krankengeld.
Frauen, die in der gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, erhalten während der gesetzlichen Mutterschutzfrist Mutterschaftsgeld.
Der gesetzliche Mutterschutz beträgt sechs Wochen vor der Geburt (vor dem voraussicht- lichen Entbindungstermin) sowie acht Wochen nach der Geburt. In dieser Zeit unterliegt die werdende Mutter einem Beschäftigungsverbot. Als Mutterschaftsgeld wird das durch- schnittliche Nettoarbeitsentgelt der letzten drei Beschäftigungsmonate gezahlt, maximal jedoch 13,00 € täglich. Übersteigt das durchschnittliche Nettoarbeitsentgelt 13,00 € täglich, so zahlt der Arbeitgeber die Differenz zum tatsächlichen Nettoarbeitsentgelt. Somit entsteht der werdenden Mutter kein finanzieller Verlust in der Zeit des Mutterschutzes.
2.3.3Leistungen der Pflegeversicherung nach SGB XI
Die gesetzliche Pflegeversicherung finanziert verschiedene Leistungen für Pflegebedürftige. Unter anderem erbringt die Pflegekasse Pflegegeld, wenn die benötigte Hilfe bei der Pflege privat beschafft wird. Oftmals werden damit die Aufwendungen der Angehörigen gedeckt, die die Pflege durchführen.
Die Auszahlung erfolgt direkt an den Versicherten und kann von diesem frei verwendet werden. Pflegegeld wird unabhängig vom Einkommen gezahlt. Die Höhe richtet sich nach dem festgestellten Pflegegrad. Nähere Einzelheiten finden Sie in Kapitel 7.
Wohngeld soll die ungedeckten Kosten für Unterkunft decken und damit den Bezug von Grundsicherungsleistungen vermeiden. Der Wohnkostenzuschuss kann für Mieter einer Wohnung/eines Zimmers, für Untermieter, aber auch für Eigentümer eines Hauses oder einer Eigentumswohnung (sog. Lastenzuschuss) gezahlt werden. Vom Bezug von Wohngeld sind nach § 7 Abs. 1 und 3 Wohngeldgesetz (WoGG) jedoch Personen ausgeschlossen, die Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch erhalten, und Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII erhalten. Das heißt konkret, dass Wohngeld und Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II oder SGB XII nicht parallel gezahlt werden können. Deshalb ist Wohngeld nur zu beantragen, wenn durch die Wohngeldzahlung der Bedarf vollständig gedeckt wird und ein Leistungsbezug nach SGB II oder SGB XII damit vermieden werden kann.
Zuschussfähig ist die Bruttokaltmiete. Dazu gehören die Grundmiete sowie die kalten Betriebskosten wie z. B. Müllbeseitigung, Wasser und Abwasser, Treppenbeleuchtung usw. Bei der Wohngeldberechnung nicht berücksichtigt werden Heizkosten oder Kosten für die Nutzung von Möbeln, Garagen oder Stellplätzen. Berechnet wird das Wohngeld nach Höhe der Bruttokaltmiete und der Anzahl der Haushaltsmitglieder unter Abzug anzurechnenden Jahreseinkommens. Das anzurechnende Jahreseinkommen ist dabei nicht das tatsächlich zufließende Nettoeinkommen. Das Wohngeldgesetz sieht den Abzug diverser Freibeträge je nach Einkommensart pauschal vor.
2.3.5Kindergeld und Kinderzuschlag
Kindergeldkönnen Eltern für ihre Kinder beantragen, wenn sie ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben. Kindergeld wird nach dem Einkommensteuergesetz oder nach dem Bundeskindergeldgesetz gewährt. Als Kinder zählen die leiblichen Kinder oder Pflegekinder, Kinder des Ehegatten oder in den Haus- halt aufgenommene Enkel. Bis zum 18. Lebensjahr des Kindes wird Kindergeld unter den genannten Voraussetzungen gezahlt. Darüber hinaus ist eine weitere Kindergeldzahlung möglich, wenn die Kinder
•arbeitsuchend oder beschäftigungslos sind,
•sich in Berufsausbildung befinden,
•sich in einer Übergangszeit von vier Monaten befinden, z. B. bis zum Beginn der Berufsausbildung/des Studiums,
•eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht beginnen bzw. fortsetzen können,
•ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr machen.
Das Kindergeld wird dann bis zum 25. Lebensjahr weitergezahlt.
Die Höhe des Kindergeldes bestimmt sich nach der Reihenfolge der Geburt. Nach derzeitigem Rechtsstand werden für das erste und zweite geborene Kind jeweils 219,00 € monatlich gewährt, für das dritte Kind 225,00 € und für jedes weitere Kind 250,00 € gezahlt. Zuständige Leistungsträger für diese Sozialleistung sind die Familienkassen, die meist bei der örtlichen Bundesagentur für Arbeit angesiedelt sind.
Der Kinderzuschlag(KIZ) wurde zeitgleich mit der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II und der Sozialhilfe nach dem SGB XII eingeführt. Zuletzt geändert wurden die gesetzlichen Grundlagen für den Kinderzuschlag im Rahmen des Starke-Familien-Gesetz, das zum 01.07.2019 in Kraft getreten ist. Gefördert werden sollen damit gering verdienende Familien mit Kindern. Mit dieser Leistung soll der Leistungsbezug nach SGB II oder SGB XII vermieden werden.
Grundsätzlich schließen sich die zeitgleiche Gewährung von Kinderzuschlag und SGB-II- oder SGB-XII-Leistungen aus. Durch die Änderung der Berechnungsgrundlagen für den Kinderzuschlag seit 01.07.2019 rechnen die Familienkassen nunmehr jedoch mit den Einkommensverhältnissen der letzten sechs Monate vor Antragstellung. Der Bewilligungszeitraum für Kinderzuschlag beträgt grundsätzlich sechs Monate. In diesen sechs Monaten führen Änderungen im Einkommen nicht dazu, dass der Kinderzuschlag neu berechnet wird. Das heißt, nunmehr kann es auch dazu kommen, dass Kinderzuschlag und SGB-II- bzw. SGB-XII-Leistungen zeitgleich gezahlt werden.
Zur Verdeutlichung folgendes Beispiel:
Eine Familie erhält für ihre zwei kindergeldberechtigten Kinder Kinderzuschlag. Die Bewilligung erfolgte für den Zeitraum 01.08.2019 bis 31.01.2020 aufgrund der Einkommensverhältnisse vom 01.02.2019 bis 31.07.2019. Berechnungsgrundlage ist das in diesem Zeitraum zugeflossene Einkommen, egal ob einmaliges oder laufendes Einkommen. Das zugrunde gelegte Einkommen ist hier das Erwerbseinkommen des Vaters. Der Vater wird jedoch zum 01.10.2019 gekündigt. Die Änderung führt seit der Einführung des Starke-Familien-Gesetzes weder zur Neuberechnung noch zum Wegfall des Kinderzuschlags, da Berechnungsgrundlage das Einkommen der sechs Monate vor Antragstellung ist und nicht das tatsächliche während des Bewilligungszeitraums
Stellt die Familie zur Sicherung des Lebensunterhalts einen Antrag auf SGB-II-Leistungen, wird Kinderzuschlag als vorrangige Leistung als Einkommen für die Zeit bis zum 31.01.2020 berücksichtigt.
Читать дальше