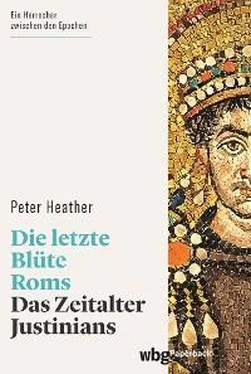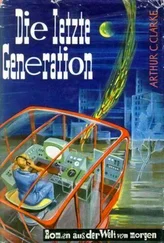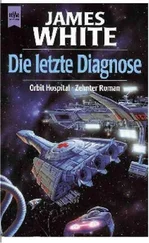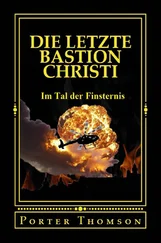Gegenüber dieser Neudefinition seiner religiösen Autorität blieben die meisten anderen Elemente des kaiserlichen Amtes im Wesentlichen unverändert. Was die Zivilgesellschaft betraf, so galt es als Pflicht des Kaisers, die wichtigsten Institutionen der civilitas zu schützen, indem er Vorgaben machte, wie der Verwaltungsapparat und die Beamten, aus denen dieser Apparat bestand, das Reich zu regieren hatten. Laut Themistios, einem politischen Berater des Kaisers im 4. Jahrhundert, war die wichtigste kaiserliche Tugend in diesem Zusammenhang die Philanthropie: die Liebe zu den Menschen (und zwar zu allen Menschen, nicht zu ein paar Auserwählten oder Gruppen). In den ideologischen Konstrukten der Griechen und Römer war dies die göttliche Tugend schlechthin; sie ermöglichte es dem Kaiser, für alle seine Untertanen zu sorgen, indem er die wichtigsten gesellschaftlichen und kulturellen Institutionen förderte, die die civilitas stützten. In der Praxis bedeutete es, dass der Kaiser in einer ganzen Reihe wichtiger Bereiche angemessen handeln musste (oder zumindest so tun musste, als handelte er so). Was das Rechtssystem betraf, so musste er die juristischen Strukturen aufrechterhalten, die die Römer immer häufiger als zentrales Merkmal wahrnahmen, durch das sich ihre zivilisierte Gesellschaft von all den barbarischen Nachbarvölkern unterschied. Ab dem ausgehenden 3. Jahrhundert waren in der römischen Welt größtenteils die Kaiser für die Gesetzgebung zuständig; sie galten für gewöhnlich als »lebendiges Recht« – auf Griechisch nomos empsychos. 13Sie konnten Gesetze erlassen (und manchmal auch brechen), wie es ihnen beliebte, doch da das Recht in ideologischer Hinsicht eine so wichtige Rolle spielte, mussten sie stets in der Lage sein zu demonstrieren, dass das, was sie taten, die Ideale der vernünftigen civilitas unterstützte, auch wenn es sich in Wirklichkeit – wie nicht selten der Fall – ganz anders verhielt.
Eine zweite wichtige zivile Funktion des Kaisers bestand darin, alle hohen Beamten zu ernennen, die in ihrer Gesamtheit den Herrschaftsapparat bildeten. Der Kaiser war der oberste Autokrat, aber wie jeder Autokrat, der über riesige Gebiete mit eingeschränktem Bürokratieapparat herrscht, erledigten de facto seine Beamten die Regierungsgeschäfte; diese besaßen ein hohes Maß an Autonomie. Die ersten Phasen seiner Regierungszeit war ein Kaiser folglich mit der Ernennung neuer Beamter beschäftigt und damit, Beziehungen zu einer ganzen Reihe lokaler Lobbyisten herzustellen, um sich so ein funktionierendes Regime aufzubauen. Wiederum wurde viel von dem, was da geschah, von der Realpolitik diktiert, doch wie Themistios es ausdrückte, formte ein Kaiser den Charakter seines Regimes durch die persönlichen Qualitäten seiner »Freunde«, mit denen er die Machtpositionen besetzte. Der Prozess, wenn der Kaiser seinen Herrschaftsapparat einrichtete, musste zumindest nach außen hin so wirken, als stärke er die civilitas, und dazu brauchte er Repräsentanten, die über passende persönliche Eigenschaften verfügten. 14
Aus ähnlichen Gründen suchten die Kaiser immer wieder nach Situationen, in denen sie demonstrieren konnten, wie sie lokale Bildungs- und Regierungseinrichtungen unterstützten, die als Grundbedingung der civilitas galten (auch wenn ihr Handeln dann in Wirklichkeit wenig mehr als Fassade war). Lehrstühle zu vergeben, war immer ein guter Schachzug, genau wie alles, das als Unterstützung der lokalen Selbstverwaltung der städtischen Eliten durchging. Auch wenn die ständige Einmischung durch die zentrale Reichsregierung die lokale Autonomie der Bürger in der Realität immer weiter ausgehöhlt hatte, übten diese kulturellen ideologischen Imperative auch im christlichen Reich des 6. Jahrhunderts noch eine gewisse Kraft aus. Und obwohl Prokop in den Bauten die größte Emphase auf das Christentum und die Verteidigung legt, kam der Stadt als einzig möglichem Kontext für ein wirklich zivilisiertes Leben immer noch eine gewisse Bedeutung zu. So beschreibt Prokop in den 550er-Jahren, wie sich Caput Vada (im heutigen Tunesien) verändert hat, seit dort zwanzig Jahre zuvor Belisars Invasionsstreitmacht landete:
Die Bauern haben den Pflug beiseitegelegt und sind nun eine Gemeinschaft, die sich nicht mehr landwirtschaftlichen Aufgaben widmet, sondern ein städtisches Leben führt. Tagsüber sind sie auf dem Forum und halten Versammlungen ab, um die Fragen zu erörtern, die sie beschäftigen; und sie treiben Tauschhandel miteinander und widmen sich all jenen Dingen, die die Würde des Städters ausmachen. 15
Die alte zivilisatorische Kraft, die der lokalen Selbstverwaltung innewohnte, war – zumindest theoretisch – immer noch quicklebendig.
Der vom christlichen Gott persönlich für seine Aufgabe ausgewählte Kaiser hatte auch wichtige militärische Pflichten. Bis weit ins 4. Jahrhundert hinein nahmen die Kaiser als Militärkommandanten aktiv an Feldzügen teil, und manche wurden vor allem deshalb in dynastische Interregna berufen, weil sie bereits bekannte Feldherren waren, so zum Beispiel Valentinian I. und Theodosius I. Doch das Amt des Kaisers behielt seine allgemeine militärische Funktion – oder besser: Verantwortung – auch dann noch bei, als die Kaiser Ende des 4. Jahrhunderts damit aufhörten, persönlich mit in den Krieg zu ziehen. Im Jahr 402 wertete der Dichter Claudian den Sieg der weströmischen Armeen über die gotischen Streitkräfte Alarichs als persönliche Leistung von Kaiser Honorius. 16Dabei hatte Honorius in Wirklichkeit keinen Fuß auf das Schlachtfeld gesetzt, denn er war damals erst zwölf Jahre alt. Und die Schlacht endete auch gar nicht mit einem Sieg der Römer, sondern ging unentschieden aus. Der springende Punkt hier ist jedoch nicht, dass Claudian es mit der historischen Wahrheit nicht so genau nimmt: Entscheidend sind seine Gründe dafür, Honorius’ Beitrag zu dem fiktiven Triumph zu verklären.
In der gesamten Geschichte der römischen Kaiserzeit galt eine Tugend als wichtigstes Charaktermerkmal eines Herrschers: die Fähigkeit, auf dem Schlachtfeld den Sieg davonzutragen. Dass sich daran auch mit dem Aufkommen des Christentums nichts änderte, hatte einen ganz einfachen Grund: Ein militärischer Sieg zeitigte eine weitaus größere ideologische und politische Wirkung als jeder religiöse oder zivile Akt. Letztere beiden Dimensionen des kaiserlichen Amtes – darunter die Beilegung theologischer Streitfragen, Gesetze, die die civilitas sicherstellten usw. – konnte als mögliches Zeichen göttlicher Begünstigung gesehen werden (und wurde es auch regelmäßig), aber die Taten eines Kaisers an diesen »Fronten« waren anfechtbar und wurden immer wieder infrage gestellt. Wurde eine theologische Streitfrage entschieden, gab es dabei immer auch Verlierer in den eigenen Reihen – und sie leugneten oft jahrzehntelang die Legitimität der Entscheidung. Der Streit um die Person Christi innerhalb der Dreifaltigkeit, der eigentlich im Jahr 325 in Nicäa »beigelegt« wurde, ging de facto noch drei Politikergenerationen lang weiter. Wie die folgenden Kapitel zeigen, beschäftigte Justinian Mitte des 6. Jahrhunderts ein weiterer kirchlicher Disput, der theoretisch bereits 451 auf dem Konzil von Chalkedon entschieden worden war. Bei der Gesetzgebung war es ähnlich: Es gab kein Gesetz, das allen Menschen auf die gleiche Weise von Nutzen gewesen wäre (auch wenn die kaiserliche Propaganda dies gerne behauptete). 17
Kurz: Ein militärischer Sieg besaß eine größere legitimierende Macht als jede andere kaiserliche Aktivität. Der allmächtige Gott konnte kein deutlicheres Zeichen seiner Gunst senden als einen kolossalen militärischen Sieg über die den Römern innerhalb der göttlichen Schöpfungsordnung per definitionem untergeordneten Barbaren. Während der gesamten römischen Kaiserzeit waren die Kaiser bei allem, was sie taten, darauf bedacht klarzustellen, dass sie im Einklang mit dem göttlichen Plan für die Menschheit handelten. Und in ideologischer Hinsicht gab es dabei nichts, das einem militärischen Sieg gleichgekommen wäre. Selbst wenn ein Kaiser wie der junge Honorius die Truppen nicht persönlich ins Feld führte, konnte eine siegreiche Schlacht seine gottgegebene Legitimität beweisen: Die Feldherren hatten ja in seinem Namen gekämpft. Damit schloss sich der ideologische Kreis. Ein legitimer Kaiser hatte göttliche Kräfte hinter sich, die sich in einem Sieg auf dem Schlachtfeld manifestierten. Und andersherum brachte ein militärischer Erfolg eben mehr politische Legitimität mit sich, als es jede andere Tat eines Kaisers vermocht hätte. 18
Читать дальше