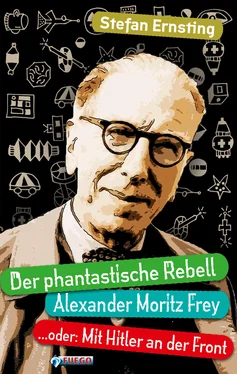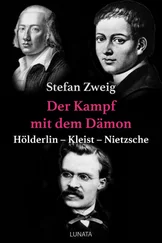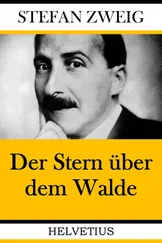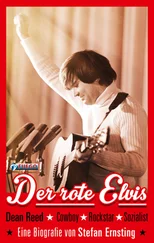1913 erschien Freys erstes Buch im Münchener Delphin-Verlag, eine Sammlung gesammelter Erzählungen aus der »Licht und Schatten« mit dem Titel »Dunkle Gänge. 12 Geschichten aus Nacht und Schatten«. Die Kurzgeschichten in »Dunkle Gänge« standen weitestgehend in der Tradition von Edgar Alan Poe, den Frey schon als Jugendlicher verehrt hatte. Sein eigener Stil war noch nicht ganz ausgeprägt, aber bereits deutlich zu erkennen. Dr. J. A. Beringer schrieb in der »Neuen Badischen Landeszeitung«: »Frey behandelt in seinen Erzählungen Begebnisse ›aus Licht und Schatten‹, Begegnungen im Reiche der vierten Dimension, dort wo Wirklichkeit und Träume sich berühren, wo Realitäten zu Schemen werden, wo der wissenschaftliche Forscher vor den Rätseln von Raum und Zeit, von Zufall und Schicksal, von Geschehnis und Geisterwelten steht. Frey hat mit einer seltenen Feinfühligkeit für den oft dämonisch-geisterhaften, oft geheimnisvoll-angreifenden Charakter seiner Stoffe den Ton getroffen und einige der Geschichten sind geradezu Meisterstücke ruhiger und doch bezwingender und im Banne haltender Erzählungskunst.« (KUD, S. 285) Der expressionistische Schriftsteller Paul Zech (»Villon«) schrieb über »Dunkle Gänge«: »Zu den wenigen jüngeren Schriftstellern, die das Erbe Edgar Poes mit dem richtigen Instinkt aufnahmen und damit wucherten, gehört A. M. Frey. Er stellt sich mit seinem Erstling gleich in die vorderste Reihe der Erzähler dieser exponierten Gattung von Belletristik.« (BLDUPL) Gero von Wilpert nannte Frey einen »weitgehend unterschätzten Erzähler skurriler phantastischer Nachtstücke, Spukgeschichten und Traumgesichter in der Nachfolge E.T. A. Hoffmanns« (von Wilpert, S. 396).
Frey spielte noch mit den Möglichkeiten und Konventionen der Phantastik. Vor allem die lebenden Toten hatten es ihm angetan. Versuchsweise nahm er den Umweg über die klassische Gespenstergeschichte (»Das unbewohnte Haus«), aber meist ging er mit drastischer Direktheit zur Sache. Zwar hielt er sich noch an die unterhaltenden Elemente des phantastischen Genre, aber er fand immer wieder einen Weg um mit den Erwartungen des Lesers zu brechen. In »Die beiden Masken«, einer Hommage an »The Masque of the Red Death« aus der Feder Edgar Alan Poes, versucht eine lebenslustige Frau beim Maskenball einem anderen Gast seine Maske zu entreißen. Die Maske des flüchtenden Unbekannten enthüllt ein schwarzes Loch als Gesicht und die Frau bricht röchelnd zusammen. Ein weiterer Gast erklärt, es handele sich hierbei um eine Parabel: Während die junge Frau ihre Verzweiflung hinter einer gesellschaftlichen Maske des Frohsinns verborgen hatte, repräsentierte der maskierte Unbekannte die falsche Oberflächlichkeit und Hohlheit der Gesellschaft, die sie täglich zu bekämpfen hatte.
Die düstere Ironie von Alexander Moritz Frey kommt in dieser Geschichte voll zum tragen. Auch der Rest der Sammlung seines Schaffens aus der »Licht und Schatten«-Zeit ist von makabrem Pessimismus geprägt. In »Weltuntergang« wird die Welt über Nacht von Dunkelheit eingehüllt. Sonne und Mond scheinen erloschen. Die Geschichte beginnt mit der Beschreibung einer »Riesenstadt«:
»Es war um Mitternacht. Ich schritt durch die Hauptstraßen einer Riesenstadt, durch ihr unaufhörlich schlagendes Herz. Gleich seinem Blutstrom pulste ein Wirrwarr von Menschen und Wagen an mir vorüber, einmal durch helle Lichtkreise wimmelnd, dann in braune Dämmerung verwoben, dann von der schwarzen Leere der Seitengassen aufgeschluckt. Bunte Geräusche, in eine ewig brandende Woge verflossen, quollen aus engen Häuserzeilen empor und verebbten in der Dunkelheit. Weiße Augen rasten die Straßen entlang - glotzten ganz aus der Nähe - schlossen sich plötzlich. Bläuliche Lichter schwebten groß und ruhig über Fahrdämmen, fahlgrüne stachen über Hoteleingängen, gelbe winkten aus Gasthäusern, rote lockten aus der heimlichen Ferne einer Nebenstraße - Lichter, gegen die eine grenzenlose Finsternis von allen Enden ankämpfte, lautlos und hartnäckig, ihrer stillen Überlegenheit sich bewusst - Nacht für Nacht.« (DG, S. 185)
Die Menschen versammeln sich auf einem Berg und gucken mit Fernrohren in den Himmel. Die Dunkelheit lastet auf ihren Schultern und Stunde um Stunde wird die Stimmung auf dem Berg ein wenig düsterer. »Man soll anfragen - drüben in Amerika - wie es mit der Sonne steht« (DG, S. 189), wird beschlossen. Frey beendet die Geschichte ohne wirklich zum Schluss zu kommen. Antworten auf die Frage, warum es überhaupt zum Weltuntergang kam, waren von ihm nicht zu erwarten. »Ein kleiner alter Mann stand neben mir in die Menge gekeilt. Er hatte den Hut verloren, seine spärlichen, weißen Haare bäumten sich wild. Er reckte den Hals, schob die Brille unaufhörlich von der Nase auf die Stirn und wieder zurück und konnte doch keinem seiner Nachbarn bis an die Schulter gucken. Mit einer zittrigen und zerdrückten Stimme, zu der die wilden Haare ein wenig paßten, winselte er wie aus einem Schacht herauf zu mir: ›Wir werden nichts erfahren. Sehen Sie, wir werden nichts erfahren! So geht es immer in solchen Fällen!‹« (DG, S. 189 f.) Die Sonne kam nicht wieder, aber mehr erfuhr man tatsächlich nicht. Die Masse, die sich eben noch wie wild gebärdete, hockte stumpf auf dem Berg ohne sich zu verändern. Wenn Frey sich auch später für wissenschaftliche Katastrophen-Theorien begeisterte, interessierte ihn vor allem die Hoffnungslosigkeit der fiktiven Situation.
Bis 1914 ließ Frey die Welt in zwei weiteren phantastischen Erzählungen (»Der Fremde« & »Der Träumende«) erneut untergehen und verweigerte weiterhin den Entwurf einer Utopie. In »Der Fremde« ließ er den Tod als »Laternenanzünder« auftreten und zeichnete trotz literarischem Schabernack ein traumartiges Bild der Hoffnungslosigkeit. Frey glaubte nicht an eine Gesellschaft mit der Möglichkeit zur Veränderung und machte dies mit »Weltuntergang« bereits in seiner ersten veröffentlichten Erzählung deutlich. Friedemann Berger schrieb in seinem Nachwort zu »Solneman der Unsichtbare«: »Während die positiven oder negativen Utopien der Aufklärer die Vorstellungen einer Veränderbarkeit der Gesellschaft zumindest als moralisch-optimistisches Postulat niemals preisgaben, hat sich für Frey nach hundert Jahren Elend der Aufklärung der Gegensatz als unüberbrückbar festgeschrieben zwischen Bürgergesellschaft und Individuum, in dessen schöpferischer Potenz bereits die Wurzeln zur Utopie liegen und dessen Namenlosigkeit eine Bedingung ist, die individualistisch-utopische Existenz rein führen zu können. Daß eine solche individualistische Existenz ihrerseits eine Utopie darstellt – daran lässt der Bürger-Schriftsteller Frey mit konstanter Ironie keinen Zweifel.« (Berger, in: SDU2, S. 295)
Die ersten Rezensionen seiner Bücher ordneten Frey zwar in die Reihe der phantastisch-mystischen Autoren ein, die sich vor allem der Unterhaltung widmeten, lobten aber stets seine literarischen Qualitäten, die ihn von den meisten seiner Kollegen unterschieden. Alexander Moritz Frey schätzte neben Edgar Alan Poe auch den Franzosen Jules Verne und den Engländer H. G. Wells, aber die Instrumente der Unterhaltung waren für ihn nur Mittel zum Zweck. Eine Existenz als Produzent massentauglicher Geschichten über Geister, Raketen oder verglühende Planeten kam für ihn nicht in Frage. Frey schrieb auch in bitterster Armut niemals eine jener Geschichten, in denen die Menschheit in letzter Sekunde durch den Geistesblitz eines genialen Wissenschaftlers doch noch gerettet wird. Was nicht bedeuten soll, dass Alexander Moritz Frey nicht vorzüglich zu unterhalten wusste. Das Schreiben für die breite Masse, die er verachtete, war ihm einfach fremd. Schon früh hatte er sich auch für andere Künste interessiert, um seinen Horizont zu erweitern und nicht irgendwann als »typischer Vertreter« einer literarischen Mode abgeschrieben zu werden. Frey war mit dieser Haltung weit entfernt von den Werken anderer deutscher Phantastik-Autoren, die sich zu dieser Zeit entweder ausführlich mit Okkultismus beschäftigten oder bereits als Vorläufer der Science Fiction gelten mochten. Friedemann Berger schrieb: »Schon für die zeitgenössische Kritik unterschied sich Freys Phantastik von jener der neuen Phantasten durch ihren existentiellen Ernst.« (Berger, in: SDU2, S. 292)
Читать дальше