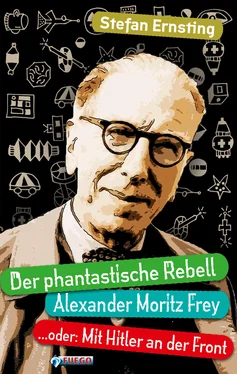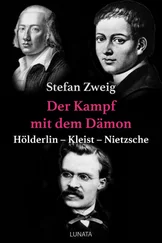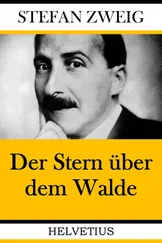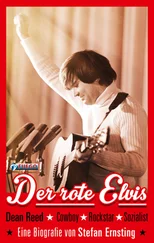Der zurückhaltende Frey war schon in jungen Jahren sehr belesen und erwies sich für Beuttenmüller als außerordentlich nützlich. Er benutzte Frey, der das entsprechende Gespür dafür zu haben schien, um weitere Autoren für seine Anthologien zu gewinnen. Erst 1928 lehnte sich Frey zaghaft gegen Beuttenmüllers Geschäftsgebaren auf und klagte am 8. Juni schriftlich ein ausstehendes Honorar ein, schließlich sei er »darauf angewiesen, vom Gewinn (s)einer Arbeiten zu leben.« (KHW, S. 105)
Frey publizierte weiterhin gelegentlich Gedichte, konzentrierte sich aber bald vor allem auf Kurzgeschichten und Erzählungen. Seine ersten Erzählungen erschienen bei Beuttenmüller im »Deutschen Novellenbuch« (Leipzig, 1910) und in »Heitere Geschichten« (4 Bände, Leipzig, 1910-1913). Im Oktober 1910 erschien seine Kurzgeschichte »Weltuntergang« in der Nr. 3 von »Licht und Schatten. Wochenschrift für Schwarzweisskunst und Dichtung«, einer illustrierten literarisch-künstlerischen Zeitschrift mit expressionistischem Einschlag, die von 1910 bis 1916 erschien und längst in Vergessenheit geraten ist. Neben den Brüdern Mann schrieben Hermann Hesse, Christian Morgenstern, Stefan Zweig oder Vicky Baum für die Zeitschrift, die Kunst und Literatur gleichermaßen Platz einräumte. Die Illustrationen stammten von Künstlern wie Alfred Kubin, Käthe Kollwitz, Carl Spitzweg, Max Liebermann und Lyonel Feininger. Einzelne Exemplare der Zeitschrift können allerdings nur noch bei einigen wenigen Sammlern bewundert werden. Die Literaturwissenschaft hat die »Licht & Schatten« bis heute nicht entdeckt und so ist nur sehr wenig über die Geschichte der Zeitschrift bekannt.
Entstanden war die »Licht und Schatten« aus dem Engagement des Druckereibesitzers Josef Molling aus Hannover, der sich von einer Konkurrenz zum »Simplicissimus« Profit versprach. Der Herausgeber Hanns von Gumppenberg (1886-1928), auch unter den Pseudonymen »Jodok« oder »Immanuel Tiefbohrer« bekannt, war ein notorischer Unruhestifter und in München bereits als Schriftsteller, Theaterkritiker und Satiriker aufgefallen. 1891 hatte er der frisch gegründeten »Gesellschaft für modernes Leben« in München eine Reihe Parodien prominenter Lyriker vorgetragen, die zehn Jahre später unter dem Titel »In allen Gangarten vorgeritten« auch als Buch erschienen. Er »entfesselte damit den verhaltenen Ingrimm der Reaktionären zu heftigem Protest«, wie von Gumppenberg in seinen »Lebenserinnerungen« schrieb. 1901 gründete von Gumppenberg, der gerade zwei Monate Festungshaft wegen »fahrlässiger Majestätsbeleidigung« absolviert hatte, im »Alten Simpl« das erste Münchener Kabarett, die legendären »Elf Scharfrichter«.
Josef Molling ließ seinen Herausgeber und Chefredakteur von Gumppenberg 1909 ein Preisausschreiben mit Hauptpreisen zwischen 1000 und 1500 Mark veranstalten, um »junge Talente« zu finden. Die Jury, der u. a. Thomas Mann angehörte, hatte aus über 1000 Zuschriften auszuwählen. Die Rechnung ging auf. Die »Licht und Schatten« konnte von Anfang an auf eine Reihe hervorragender Autoren zurückgreifen. Alexander Moritz Frey gehörte schon früh zur Stammbesatzung, wenn er auch keinen der Preise gewonnen hatte. Die »Licht und Schatten« hatte einen hervorragenden Ruf, erschien überregional und war wie gemacht für die Schreibe von Alexander Moritz Frey. Frey fand in der »Licht und Schatten« den ersten regelmäßigen Abnehmer für seine Kurzgeschichten und wurde auf Augenhöhe mit den größten Namen gedruckt, die der Literaturbetrieb im Kaiserreich zu bieten hatte. Für ihn war die Veröffentlichung in der »Licht und Schatten« eine Befreiung. Er war nicht länger auf den Münchener Kleinverleger Beuttenmüller angewiesen, der von ihm erwartete, die eigenen Werke im Bauchladen selbst zu verkaufen. Frey schrieb bereits am 17. Februar 1910, Monate vor Erscheinen der Startnummer von »Licht und Schatten«, euphorisch an Hermann Beuttenmüller, er würde demnächst regelmäßig für eine »neu erscheinende Zeitschrift« (KHW, S. 112) schreiben, deren Namen er nicht nennen könne.
Leben konnte Frey von seinen Veröffentlichungen noch nicht. Sein Lebensunterhalt schien zunächst durch einen Künstlerfonds gesichert worden zu sein, mit dem er sich für kurze Zeit über Wasser halten konnte. Nach dem Tod des Vaters im Jahre 1911 kam später eine kleine Erbschaft dazu, die es ihm ermöglichte, sich weiterhin auf seine literarische Arbeit zu konzentrieren. Frey schrieb in stiller Bescheidenheit und kam auch mit wenig Geld gut aus. Nebenbei rezensierte er Bücher für diverse Tageszeitungen und verdiente sich ein wenig Taschengeld dazu. Er erwies sich dabei als genauer Kenner der Literatur seiner Zeit und schrieb bis zu seinem Tod über 800 Rezensionen. Seine besondere Vorliebe galt der phantastischen Literatur klassischer Prägung.
Alexander Moritz Frey gehörte zu den frühen Wegbereitern der modernen Phantastik, wenn er als deren Vertreter zunächst auch eher untypisch wirkte. Er entstammte einer Tradition, die man Ende des 19. Jahrhunderts meist als »seltsame Geschichten« beschrieb und bis heute nicht richtig in die Literaturgeschichte einordnen konnte. Der Begriff des Phantastischen in der Literatur wird seitdem immer wieder diskutiert. Der französische Schriftsteller Charles Nodier wollte mit seinem Aufsatz »Du fantastique en littérature« schon 1830 den »gewagten Versuch, das Phantastische zu definieren, nicht unternehmen.« Das Spektrum erschien ihm zu groß und so beließ er es beim Versuch, »das Gebiet des Phantastischen einzugrenzen.« Sehr viel weiter ist die Forschung bisher nicht gekommen und moderne Phantasten wie Jorge Luis Borges oder Thomas Pynchon machen es der Literaturwissenschaft noch schwerer. Klar scheint nur, dass sich die phantastische Literatur Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt hat und während des 19. Jahrhundert in voller Blüte stand. Roger Caillois schrieb in seinem oft zitierten Aufsatz »L‘Image fantastique«: »Im Phantastischen offenbart sich das Übernatürliche wie ein Riß in dem universellen Zusammenhang. Das Wunder wird dort zu einer verbotenen Aggression, die bedrohlich wirkt und die Sicherheit einer Welt zerbricht, in der man bis dahin die Gesetze für allgegenwärtig und unverrückbar gehalten hat. Es ist das Unmögliche, das unerwartet in einer Welt auftaucht, aus der das Unmögliche per definitionem verbannt worden ist.« (Zondergeld, Phaicon 1, S. 48) Caillois kommt einer Definition mit seinem »Riß in der Wirklichkeit« näher als viele seiner Kollegen, beschreibt aber trotzdem nur einen Teil der Phantastik. Für das frühe Werk von Alexander Moritz Frey trifft diese Definition trotzdem durchaus zu. Es fehlt in seinem Falle nur noch der Hinweis auf das humoristische Element. Rein A. Zondergeld schrieb über Alexander Moritz Frey: »Seine Position ist eine durchweg eigene: viele seiner Texte bewegen sich in einem Grenzbereich zwischen traditioneller phantastischer Erzählung, Groteske und Satire, und der Begriff des Skurrilen trifft im allgemeinen genau ihren Charakter.« (Lexikon der phantastischen Literatur, S. 97)
Frey war ein glänzender Satiriker und jeder seiner Texte ist von einem feinen Humor durchzogen, den das Gros der deutschen Phantastik-Autoren vermissen ließ. Frey unterschied sich damit von seinen bekannteren Zeitgenossen Paul Scheerbart (1863-1915) oder Gustav Meyrink (1868-1932), die sich ebenfalls von den klassischen Schauergeschichten fortbewegten, die man nur als ablenkende Unterhaltung verstanden wissen wollte. Scheerbart, dessen skurriler »Mondroman« ironisch die Kriegstreiberei der Erdenbewohner entlarvte, gelang dies auf spielerische Art. Gustav Meyrink ging zunächst ähnlich wie Frey satirisch zur Sache, verlor sich aber mit seinen »Magischen Romanen« in mystischen Spinnereien. In seinem mehrfach verfilmten Erfolgsroman »Der Golem« (1915) verband Meyrink die Gegenwart mit der jüdischen Sagenwelt und in »Das grüne Gesicht« (1916) gelang ihm eine bedrückende Schilderung des Amsterdamer Ghettos, die er mit der Legende vom »ewigen Juden« verband. Seine beiden letzten Romane beschäftigten sich allerdings nur noch mit dem Geheimbund der Rosenkreuzler und ließ den engagierten Geist der frühen Werke des »Simplicissimus«-Mitarbeiters vermissen.
Читать дальше