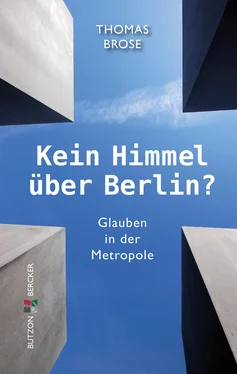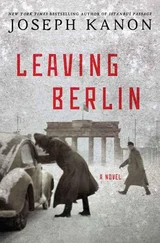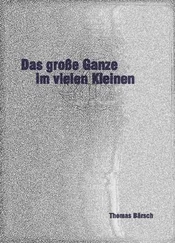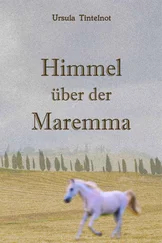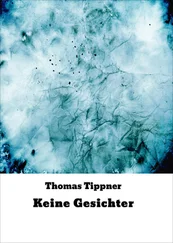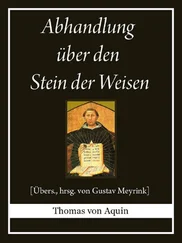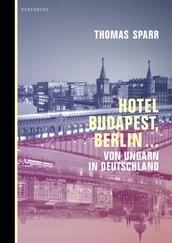Meine Sorgen sind beim Blättern in einem Erstkommunionbuch zur Ruhe gekommen, aber selbst heute erscheinen sie mir nicht völlig unbegründet. Einen vergleichbaren öffentlichen Laden, der sich als katholische Buchhandlung entpuppte, hatte ich noch nie gesehen. An jenem Tag habe ich in der Schule des Lebens etwas Wichtiges dazugelernt: Die Welt war doch nicht so eindeutig in Schwarz und Weiß geteilt: in Religiös und Atheistisch, in einen privaten Bereich, in dem der Glaube einfach dazugehörte, und in einen schulischen, in dem ein sonntäglicher Kirchgang vom Lehrer mit Lachen und Spott bedacht wurde: „Religion ist was für alte und ungebildete Menschen, die es nicht schaffen, sich auf unsere neue Gesellschaft einzustellen.“
Dagegen wusste ich plötzlich: Mitten in Berlin existiert ein kleines Reich, in dem ein anderer Geist regiert. Hier bildeten die Welt der Bücher und die Welt des Glaubens eine harmonische Einheit. Auf dem Heimweg in der S-Bahn, der mir sehr lang vorkam, habe ich mir über dieses erstaunliche Lese-Land Gedanken gemacht. Ich hatte genug Muße, mir den Namen des Buchladens einzuprägen. Ich fand, er passte gut: „Sonnenhaus Ziegler“.
Dieser Besuch blieb nicht ohne Folgen. Wenn sich unsere Familie in größeren Abständen entschloss, aus dem Umland ins Berliner Zentrum zu fahren, um dort knappe, begehrte Güter und Gerätschaften zu kaufen, bat und bettelte ich, bis ein kurzer Abstecher zum „Sonnenhaus“ genehmigt wurde. Bei solchen Streifzügen wechselten dann nicht nur elektronische Geräte und seltene Südfrüchte den Besitzer, sondern auch Kerzen und christliche Bücher. Wenn ich heute mit dem Finger über meine Bücherregale fahre, finde ich noch einige Bände, die von solchen Tagestouren stammen. Dabei entdecke ich auch Titel aus dem St.-Benno-Verlag, die mir später meine ältere Schwester geschenkt hat und die dem damals Zwölf- oder Dreizehnjährigem ziemlich komisch vorkamen: Glaube – Gnosis – Griechischer Geist oder Theologisches Jahrbuch 1975 , in dem mir, wie einige Anmerkungen mit Bleistift zeigen, ein Artikel über Die Unbrauchbarkeit Gottes in einer säkularisierten Welt zumindest kurzfristig Kopfzerbrechen bereitet hat.
Bücher in totalitären Systemen – eine brisante Sache! Darum wurde die Verteilung dieser gefährlichen Güter vom staatlich organisierten Buchhandel genau reglementiert. Guter Lesestoff war knapp. Er gelangte zuerst in die Buchläden der NVA, der „Nationalen Volksarmee“, in die Regale sogenannter gesellschaftlicher Einrichtungen und Betriebe und schließlich in den Volksbuchhandel. Das katholische „Sonnenhaus“ musste sich ganz am Schluss der Leseschlange anstellen und darauf warten, was übrig blieb. Bestellungen beim „VD“, dem zentralisierten Vorankündigungsdienst, wurden oft ignoriert. Einen Vorteil aber hatte der Laden: Er durfte auch die Produktion kirchlicher Verlagshäuser, des Benno-Verlags in Leipzig und der Evangelischen Verlagsanstalt in Berlin, im Sortiment führen.
Weil die „Sonnenhäusler“ aber ständig im gesamten Ostteil des Bistums – von der Insel Rügen bis hinauf nach Brandenburg – mit ihren Büchertischen unterwegs waren, wurden sie nicht wie eine private, sondern fast wie eine kirchliche Institution betrachtet. Sie konnten sich auf ihre treue Stammkundschaft in den Gemeinden verlassen. Natürlich fühlten sich auch Touristen vom unkonventionellen Charme des Ladens angezogen. So mischte sich in den engen Gängen zwischen Bücherstapeln meist ein buntes Publikum.
Genau weiß ich nicht mehr, ob ich Zeuge dieses Dialogs war oder ob mir davon erzählt wurde. Jedenfalls ist er für das besondere Klima im „Sonnenhaus“ geradezu typisch: Ein Kunde fragt, wo ein soeben erschienener Band von Böll oder Frisch zu haben sei. Darauf Rudolf Ziegler: „Da müssen sie bloß zwei Stationen mit der S-Bahn fahren.“ „Also von hier aus bis zur Jannowitzbrücke?“ „Nee, andere Richtung.“ Jeder wusste natürlich, dass die nächste Station Friedrichstraße hieß und dass dort die Grenze zum Westen verlief. Es gab nicht gerade viele, die die Chuzpe aufbrachten, so zu reden. Überhaupt muss Rudolf Ziegler, der die Unabhängigkeit seines Bücherreichs lebenslang verteidigte, ein ungewöhnlicher Mann gewesen sein. Kaum 24 Jahr alt, eröffnete er 1925 mit großer Begeisterung für den Quickborn den katholischen „Buch- und Werkladen Sonnenhaus“.
Ich würde einiges darum geben, um zu erfahren, was sich der Bücher-Patriarch dabei dachte, als er meiner fürsorglichen Schwester den Tipp gab, mir, dem fußballspielenden Tagedieb, einen Band mit Aufsätzen von Romano Guardini 28zu schenken. Später erfuhr ich, es soll öfter vorgekommen sein, dass der „Herr der Bücher“ seine Kundinnen und Kunden so beriet, dass sie den Laden mit Ausgaben von Autoren verließen, deren Namen sie vorher kaum kannten.
Das schwesterliche Geschenk verschwand auf Jahre in einem Bücherregal. Lange blieb es dort ungelesen liegen. Es dauerte seine Zeit, ehe ich diese geheime Einladung endlich annahm: Schließlich begegnete mir Romano Guardini beim Lesen, versehen mit einem Gruß vom „Sonnenhaus Ziegler“. Ich entdeckte den Religionsphilosophen zu Beginn der Achtzigerjahre, als ich bereits selbst begonnen hatte, Theologie zu studieren. Das hat mein Leben verändert. Es wurde für mich zum Anruf, im Herbst 1989 mit katholischen jungen Leuten an die Humboldt-Universität zu ziehen und dort eine Forderung zu erheben, die zur Friedlichen Revolution passte: Wir wollen, dass es für Romano Guardini hier einen Neuanfang gibt.
Himmel über der Halbstadt
Eines Tages in den 1970er-Jahren – kurz nach der Entdeckung des katholischen Sonnenhauses – fand auch ich mich plötzlich in luftiger Höhe wieder: Dabei spürte ich ein mulmiges Gefühl in der Magengegend. Immerhin hatten wir innerhalb weniger Sekunden fast 207 Meter überbrückt. Das erinnerte uns, Mädchen und Jungen aus meiner Schulklasse in einem überfüllten Fahrstuhl, an so etwas wie einen „Raketenstart“. Alle redeten aufgeregt durcheinander. Aber es mussten noch bange Momente vergehen, ehe die Stahltür aufsprang und wir laut lärmend losrennen konnten. Die halbe Klasse – und ich mittendrin – stürmte auf die kreisrunde Aussichtsplattform. Wir waren überwältigt. Mit einem Mal wurde es still. Die ungewohnte Höhe, der wunderbare Ausblick, dazu ein sanftes, sachtes Schwanken und Schwingen des ganzen Baus. Diese Herrlichkeit machte uns geradezu andächtig.
In einem Kinderlied über den Fernsehturm heißt es: „Wollt ihr hinauf zum Turmcafé, / Turmcafé, Turmcafé, / fahrt mit dem Aufzug in die Höh', / Steigt alle ein Raketenstart! / Gleich kommt der Aufzug groß in Fahrt. / Turmcafé, in die Höh, Aufzug groß in Fahrt.“ Der Besuch des monumentalen Bauwerks, den wir damals absolvierten, war zu meiner Zeit obligatorisch. Die himmelstürmende Architektur des Turms mit der markanten Kugel sollte uns, formbare Mädchen und Jungen, von der Überlegenheit des Systems überzeugen. Beim rasanten Hochfahren hatte ich tatsächlich an so etwas wie „Raketenstart“ mit gezündeten Triebwerken gedacht. Allerdings musste ich mir ernüchtert eingestehen, dass sich mein Magen dabei nicht sonderlich weltraumtauglich verhalten hatte. Jedenfalls war der äußere Rahmen unserer Exkursion zur „Stadtkrone“ ganz darauf ausgerichtet, sich tief ins Gedächtnis einzugraben. Und so habe ich diesen Augenblick in Erinnerung behalten – anders allerdings, als sich das die Ideologen ausgedacht hatten.
Ausgerechnet Walter Ulbricht war es, der mir, dem vorlauten Schüler, hoch über den Dächern der Halbstadt eine Lektion erteilte. Dass ich unter dem geteilten Berliner Himmel damals was fürs Leben lernte, halte ich heute für eine List der Geschichte. Der formidable Vorsitzende, für den Architektur gebaute Weltanschauung war und der darum Kirchen als Relikte der Vergangenheit hasste – die Leipziger Universitätskirche, die Potsdamer Garnisonkirche und die Christuskirche in Rostock ließ er bedenkenlos zerstören –, hatte sein Prestigeprojekt zum Ruhm des jungen Staates, aber mehr noch für die eigene Unsterblichkeit erbauen lassen. Zugleich konnte der Mauer-Erbauer aber nicht verhindern, dass der von der Peripherie (Müggelberge) ins Zentrum transferierte Fernsehturm zwar sein Ansehen steigerte, aber auch verdrängte Probleme der beiden Berliner Halbstädte offenkundig machte.
Читать дальше