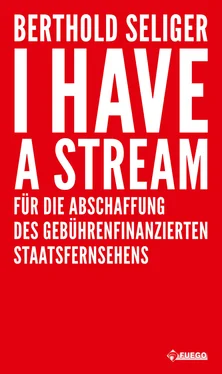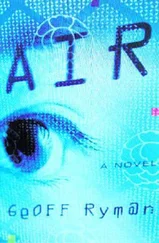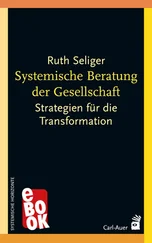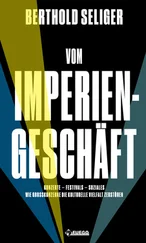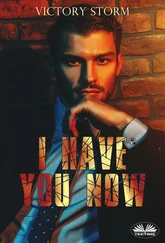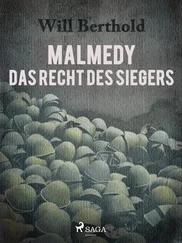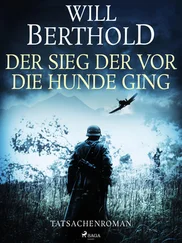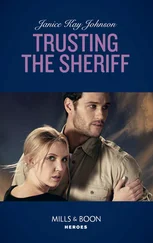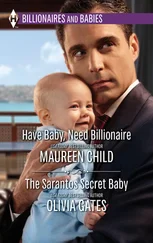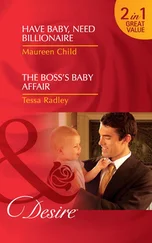Von 1952 bis 1954 wurde das Fernsehprogramm im wesentlichen vom NWDR bestritten, der 90 Prozent der Herstellung und Ausstrahlung des Gesamtprogramms übernahm. Mit dem Inkrafttreten des Fernsehvertrags für die BRD am 1. November 1954, der die Kooperation der ARD-Anstalten regelte, trugen der NWDR 50 Prozent, der Bayerische Rundfunk (BR) 20 und der Hessische Rundfunk (HR), der Süddeutsche Rundfunk (SDR) und der Südwestfunk (SWR) jeweils 10 Prozent des gemeinsamen ARD-Angebots. Nachdem aus partikularistischen Gründen 1954 der Westdeutsche Rundfunk (WDR) und 1955 der Norddeutsche Rundfunk (NDR) gegründet worden waren, traten diese Sender 1956 an die Stelle des seit 1948 von Adolf Grimme als Generaldirektor geleiteten und nun liquidierten NWDR, der damals »größten publizistischen Institution der Bundesrepublik« (Friedrich Wenzlau). 42
Bereits drei Jahre nach dem Sendebeginn der ARD drängten Interessenvertreter der Wirtschaft und Großverleger 1955 darauf, ein privatwirtschaftlich organisiertes Fernsehen zuzulassen, worin die Rundfunkanstalten eine Gefährdung ihres Sende- und Programm-Monopols sahen. Dem versuchten sie mit der Gründung eines eigenen zweiten Fernsehprogramms zuvorzukommen, das nicht vor 1960 den Sendebetrieb aufnehmen sollte, für das sie aber bereits 1957 Frequenzen beantragten. Der Bundespostminister lehnte den Antrag der ARD-Anstalten für ein »Zweites des Ersten« jedoch ab. Bundeskanzler Adenauer hatte eigene Pläne.
Schon Anfang der fünfziger Jahre hatte Konrad Adenauer erfolglos versucht, Rundfunk und Fernsehen der BRD in seinem Sinn neu zu ordnen. Die von Adenauer geführte Bundesregierung beanspruchte Kompetenzen auf dem Gebiet des Rundfunks. Die unabhängigen und oft den Interessen der konservativen Bundesregierung entgegengesetzten Landesrundfunkanstalten waren Adenauer ein Dorn im Auge. Die größte ARD-Rundfunkanstalt wurde mit Adolf Grimme von einem Mann geführt, der Kontakt mit der Roten Kapelle gehabt hatte, von der Gestapo verhaftet und 1943 zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt worden war. Unmittelbar nach der Befreiung vom Faschismus hatte Grimme Anzeige gegen den NS-Richter Manfred Roeder wegen dessen Beteiligung an den Unrechtsurteilen gegen Dietrich Bonhoeffer, Hans von Dohnanyi und 49 Mitglieder der Roten Kapelle erstattet. Grimme war von der britischen Besatzungsmacht bereits im August 1945 in führenden Positionen der Kulturpolitik eingesetzt worden. 1946 wurde er erster niedersächsischer Kultusminister. Grimme (von dem der schöne Ausspruch stammt: »Ein Sozialist kann Christ sein, ein Christ muß Sozialist sein«) stand für eine neue Bundesrepublik, die sich entschieden gegen alle Überbleibsel des Nationalsozialismus wandte und die im Rundfunk gewissermaßen eine »volkspädagogische Mission« (Wenzlau) erkannte und neue geistige, kulturelle und soziale Kräfte in Bewegung setzen wollte. Eine Provokation für den erzkonservativen Adenauer, dessen ehrgeizige Pläne Anfang der fünfziger Jahre jedoch vorerst noch von den eindeutigen Bestimmungen des Grundgesetzes ausgebremst wurden.
Doch Adenauer gab nicht auf. Die Bundesregierung wünschte sich ein zweites Fernsehprogramm, das bundesweit senden und dem Bund unterstellt sein sollte. Allerdings stand diese Konstruktion auf wackligen Füßen: Die Kulturhoheit lag (und liegt bis heute) bei den Ländern, die das neue Programm mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) unterbinden lassen konnten. Zwar bewegte sich Adenauer mit seiner Argumentation in einer Grauzone, denn das Recht, die Sendelizenzen zu erteilen, lag bei der Deutschen Bundespost, war also Bundessache. Dennoch war er unsicher, ob er ein Fernsehprogramm unter Kuratel des Bundes durchsetzen konnte, weswegen er den Ländern eine Beteiligung von 49 Prozent an seinem Zweiten Programm anbot in der Hoffnung, die Länder damit von einer Klage abhalten zu können. Die Länder lehnten dieses Angebot jedoch ab. Trotzdem gründete Konrad Adenauer am 25. Juli 1960 die »Deutschland Fernsehen GmbH« – sein eigenes »Kanzler-Fernsehen«. Adenauer unterzeichnete den Gesellschaftervertrag als Bundeskanzler, der Bundesjustizminister Fritz Schäffer als Privatperson (!) und als Treuhänder für die Länder. Die Länder jedoch akzeptierten den CSU-Mitgründer Schäffer nicht, der eine durchaus umstrittene Rolle in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte spielte. Hatte ihn schon die US-Militärregierung als bayerischen Ministerpräsidenten entlassen, weil er den öffentlichen Dienst nicht ausreichend von ehemaligen NSDAP-Mitgliedern gesäubert hatte, sorgte er als Bundesfinanzminister für einen Skandal, weil er die sogenannte Wiedergutmachungspolitik zum Teil in ihr Gegenteil verkehrte, nicht nur, indem er die Zahlungen an Verfolgte des NS-Regimes verzögerte, sondern auch, weil unter anderem Angehörige der Legion Condor mit hohen Zahlungen versehen wurden. 43
Kein Wunder, daß die Länder Fritz Schäffer als »ihren« Treuhänder ablehnten, und so wurde wenige Tage nach der Eintragung der Deutschland-Fernsehen GmbH ins Kölner Handelsregister die Satzung geändert, und der Bund übernahm auch die für die Länder vorgesehenen Anteile. Die SPD-geführten Bundesländer Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Hessen riefen das Bundesverfassungsgericht an, weil sie ihre Kulturhoheit durch das Adenauersche Kanzler-Fernsehen verletzt sahen. Adenauer und Schäffer ließen sich jedoch nicht beirren und trieben die Vorbereitungen zum Sendestart des zweiten Programms voran, der für den 1. Januar 1961 geplant war. Die Bundesländer sahen sich gezwungen, eine einstweilige Anordnung zu beantragen, die das BVerfG am 17. Dezember 1960, also zwei Wochen vor dem geplanten Sendestart, auch tatsächlich erließ. Adenauer war auf ganzer Linie gescheitert. Das spektakuläre Urteil des BVerfG wird seither auch als »erstes Rundfunk-Urteil« bezeichnet. In diesem Urteil wurde die Gründung der Deutschland-Fernsehen GmbH als nicht mit dem Grundgesetz vereinbar verworfen. Das BVerfG legte fest, daß für die Organisation des Rundfunks und Fernsehens ausschließlich die Länder zuständig sind, der Bund dagegen nur für die Rundfunktechnik. Das BVerfG sah das Bereitstellen von Rundfunk- und Fernsehprogrammen in diesem Urteil ausdrücklich als öffentliche Aufgabe an, die von Privaten nicht zu bewältigen sei. Als Faktor und Medium der Meinungsbildung müsse der Rundfunk staatsfrei organisiert sein. Auch die zentralisierte Kontrolle des Rundfunks durch die Bundesregierung hielt das BVerfG für verfassungswidrig. Aufgrund der »Lehren aus Weimar« – nämlich der zentralen Organisation des Rundfunks und der Kontrolle durch die Reichspost, was den Mißbrauch des Rundfunks für Propagandazwecke im NS-Staat begünstigt habe – sollte in der BRD ausdrücklich nur die technische Seite und nicht der Inhalt, die »kulturelle Seite«, in der Verantwortung des Bundes liegen. Im Urteil des BVerfG heißt es: Der Rundfunk gehöre »ebenso wie die Presse zu den unentbehrlichen modernen Massenkommunikationsmitteln, durch die Einfluß auf die öffentliche Meinung genommen und diese öffentliche Meinung mitgebildet wird. Der Rundfunk ist mehr als nur ›Medium‹ der öffentlichen Meinungsbildung; er ist ein eminenter ›Faktor‹ der öffentlichen Meinungsbildung.« Und: »Diese Mitwirkung an der öffentlichen Meinungsbildung beschränkt sich keineswegs auf die Nachrichtensendungen, politischen Kommentare, Sendereihen über politische Probleme der Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft; Meinungsbildung geschieht ebenso in Hörspielen, musikalischen Darbietungen, Übertragungen kabarettistischer Programme bis hinein in die szenische Gestaltung einer Darbietung.« 44
Im Monat nach dem »Rundfunk-Urteil« beschlossen die Ministerpräsidenten der Länder ein gemeinsames zweites Programm und unterzeichneten am 6. Juni 1961 den Staatsvertrag über eine »gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts mit dem Namen: Zweites Deutsches Fernsehen«. Das Zweite Deutsche Fernsehen nahm am 1. April 1963 den Sendebetrieb auf. Zwischen 1964 (BR) und 1969 (SWR) richteten die ARD-Sender ihre eigenen »zweiten Programme« ein, die sie die »Dritten« nannten.
Читать дальше