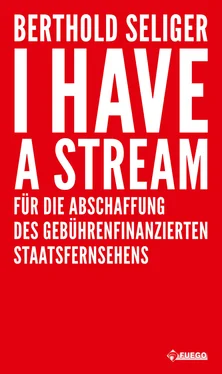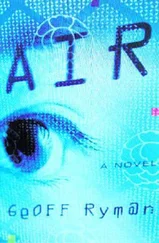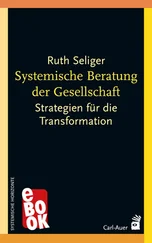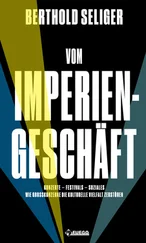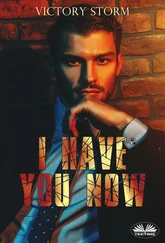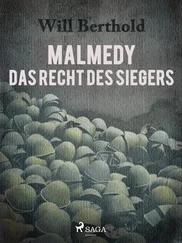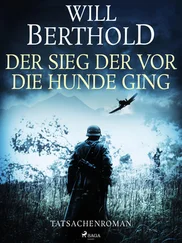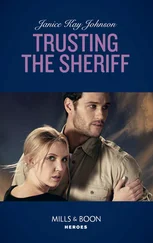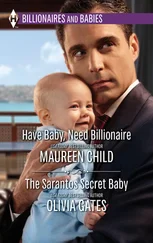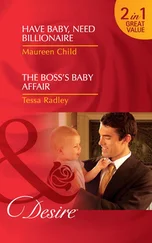Da eine Anhebung der Rundfunk- und Fernsehgebühren bereits in der Aufbauphase des öffentlichen Fernsehens nicht erwünscht war, wurde bei der Gründung des ZDF im Staatsvertrag die Fernsehwerbung als zweite Ertragsquelle ausdrücklich vorgesehen. Schon seinen zweiten Sendetag begann das ZDF mit Fernsehwerbung! Doch auch die ARD ermöglichte Werbung als zusätzliche Einnahmequelle: Am 3. November 1956 wurde im BR erstmals Fernsehwerbung gezeigt, ein 55-sekündiger Spot für das Waschmittel »Persil« mit Liesl Karlstadt und Beppo Brem. 1958 gründete der WDR eine hundertprozentige Tochtergesellschaft namens »Westdeutsches Werbefernsehen GmbH« (WWF) mit dem Ziel der Vermarktung von Werbezeiten im Vorabendprogramm. 1962 schlossen sich die Werbegesellschaften der einzelnen ARD-Sender zur »Arbeitsgemeinschaft Werbefernsehen« (AWF) zusammen.
Durch das Werbefernsehen konnten die Rundfunkgebühren lange stabil gehalten werden: 1953 betrug die Grundgebühr 2 DM, die zusätzliche Fernsehgebühr 5 DM, die Gesamtgebühr also 7 DM. 1968 forderten die Rundfunkanstalten eine Anhebung der Fernsehgebühren, und das BVerfG urteilte, daß die Länder die Hoheit über die Festsetzung der Rundfunkgebühren haben und daß die Anstalten deren alleinige Gläubiger seien. Die Gebühren wurden im Jahr 1970 entsprechend erhöht: Die Gesamtgebühr betrug nun 8,50 DM (Grundgebühr 2,50 DM, Fernsehgebühr 6 DM). 1973 beschloß die ARD-Hauptversammlung die Einrichtung eines zentralen Gebühreneinzugs, und ab dem 1. Januar 1976 betrieben ARD und ZDF das Gebühreninkasso über die Gebühreneinzugs-Zentrale (GEZ).
Auch im weiteren Verlauf der bundesdeutschen Fernsehgeschichte traf das Bundesverfassungsgericht wesentliche Entscheidungen, 1971 etwa, daß die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten nicht als Gewerbebetriebe eingestuft werden dürfen und mithin von der Mehrwertsteuer befreit sind, oder 1981 die grundsätzliche Zulässigkeit von privaten Rundfunk- und Fernsehanstalten, solange ein Mindestmaß an Meinungsvielfalt bei den Privaten sichergestellt ist (das sogenannte »dritte Rundfunk-Urteil«, das allgemein als Meilenstein auf dem Weg zur dualen Rundfunkordnung unserer Tage gilt). Wegen der damaligen Knappheit der Sendefrequenzen wurde die Zulassung der Sender gesetzlich geregelt. Das »vierte Rundfunk-Urteil« von 1986 zementierte das bis heute geltende duale Rundfunksystem. Das BVerfG entwickelt den Begriff der »Grundversorgung«, die die öffentlich-rechtlichen Sender zur Verfügung zu stellen haben. Dieser Grundversorgungsauftrag umfaßt drei Elemente: Die gesamte Bevölkerung muß die öffentlich-rechtlichen Programme empfangen können; ein gewisser inhaltlicher Standard der Programme muß gewährleistet sein; und die Programme müssen zur Sicherung der Meinungsvielfalt beitragen. Dieser klassische Rundfunkauftrag umfaßt die volle Rundfunkversorgung der Bevölkerung mit Inhalten zur Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung. Aufgrund der Werbefinanzierung der Privatsender besteht demnach die Gefahr, daß populären, massenattraktiven Programmen ein großer Teil der Sendezeit gewidmet wird, weshalb die Privatsender allein die öffentliche Kommunikationsaufgabe, die sich aus der Rundfunkfreiheit ergibt, nicht erfüllen. Laut BVerfG gibt es also auf der einen Seite die Grundversorgung durch die öffentlich-rechtlichen Sender, auf der anderen Seite die Privaten, bei denen auch ein geringerer Grundstandard an Vielfalt zulässig sei, solange es eben die Grundversorgung der Öffentlich-Rechtlichen gebe. In der Folge dieses Urteils des BVerfG wurde 1987 der Erste Rundfunkstaatsvertrag geschlossen.
In diesem und in weiteren Grundsatzurteilen hat sich das Bundesverfassungsgericht als mächtiger Freund des öffentlich-rechtlichen Fernsehens etabliert. 1991 gibt das BVerfG im »sechsten Rundfunk-Urteil« eine grundsätzliche »Bestands- und Entwicklungsgarantie« für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich im Konkurrenzkampf mit den Privaten demnach auch ausdrücklich wirtschaftlich betätigen darf. Mit diesem Urteil hat das BVerfG dem Öffentlich-Rechtlichen aber einen Bärendienst erwiesenen, wie wir heute wissen.
Betrachten wir das gültige Gesetz für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien 45(RStV), eingehender. Bereits die zweite inhaltliche Aussage der Präambel erwähnt die Verstärkung von »Informationsvielfalt und kulturellem Angebot«, noch einen Absatz vor der bereits erwähnten Bestands- und Entwicklungsgarantie. In den ersten drei Paragraphen des Gesetzes geht es um die Definition des Anwendungsbereichs, um Begriffsbestimmungen und um allgemeine Grundsätze. Dann folgt bereits ein interessanter Absatz, nämlich »§4 Übertragung von Großereignissen«, die laut Gesetzgeber »zumindest in einem frei empfangbaren und allgemein zugänglichen Fernsehprogramm zeitgleich ausgestrahlt« werden müssen. Als Großereignisse werden ausschließlich Sportveranstaltungen definiert, nämlich die Olympischen Spiele oder bei Fußball-Europa- und Weltmeisterschaften alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie Eröffnungs-, Halbfinal- und Finalspiele. Offensichtlich sind dem Gesetzgeber diese Sportereignisse besonders wichtig.
Im nächsten Paragraphen wird die »Kurzberichterstattung« über »Veranstaltungen und Ereignisse, die öffentlich zugänglich sind«, gesichert. Ein wichtiger Paragraph ist §6, in dem die Aufgabe der Fernsehveranstalter »zur Sicherung von deutschen und europäischen Film- und Fernsehproduktionen als Kulturgut sowie als Teil des audiovisuellen Erbes« festgelegt wird. Die Fernsehveranstalter müssen demzufolge »den Hauptteil ihrer insgesamt für Spielfilme, Fernsehspiele, Serien, Dokumentarsendungen und vergleichbare Produktionen vorgesehenen Sendezeit europäischen Werken entsprechend dem europäischen Recht vorbehalten«. Ihre »Fernsehvollprogramme« sollen einen »wesentlichen Anteil an Eigenproduktionen sowie Auftrags- und Gemeinschaftsproduktionen aus dem deutschsprachigen und europäischen Raum enthalten«, und »im Rahmen seines Programmauftrages ... ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk zur qualitativen und quantitativen Sicherung seiner Programmbeschaffung berechtigt, sich an Filmförderungen zu beteiligen, ohne daß unmittelbar eine Gegenleistung erfolgen muß«. Eine interessante Forderung: Ganz offensichtlich sieht der Gesetzgeber die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten zur Filmförderung ausdrücklich verpflichtet, und zwar sogar, ohne daß unmittelbar eine Gegenleistung erfolgen muß, was eine recht weitreichende Filmförderung bedeutet. Es ist die Frage, ob dieser Gesetzesauftrag wie auch viele andere heute auch nur im entferntesten erfüllt wird.
Im II. Abschnitt des RStV werden die »Vorschriften für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk« definiert. §11 enthält den vielzitierten »Rundfunkauftrag«, der an Deutlichkeit eigentlich nicht zu wünschen übrig läßt: »Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über das internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. Sie sollen hierdurch die internationale Verständigung, die europäische Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und Ländern fördern. Ihre Angebote haben der Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung zu dienen. Sie haben Beiträge insbesondere zur Kultur anzubieten. Auch Unterhaltung soll einem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entsprechen.«
Wir halten fest: Der Gesetzesauftrag der Öffentlich-Rechtlichen Sender ist eindeutig festgelegt, es geht um Bildung, Information, Beratung, »insbesondere« Kultur und »auch« Unterhaltung. Dies ist der gesetzliche Auftrag und zugleich die eigentliche Existenzberechtigung des öffentlich-rechtlichen Radios und Fernsehens.
Читать дальше