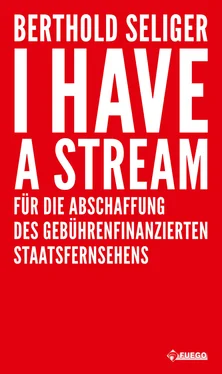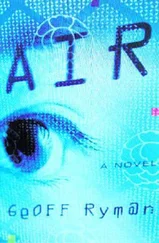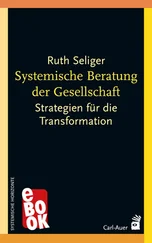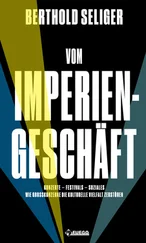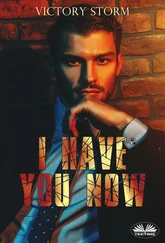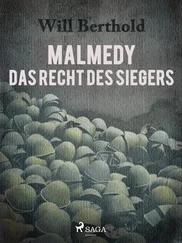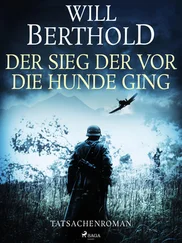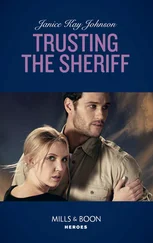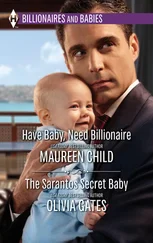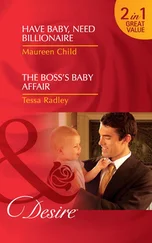Das Gros der Fernsehverantwortlichen und sicher auch nicht gerade geringe Teile der politischen Klasse freuten sich darüber, daß die Quote sie letztlich von einer inhaltlichen Diskussion über das Programm entlastete. Sendungen, die keine Quote bringen, werden auch bei ARD und ZDF sofort abgesetzt oder ins Mitternachtsprogramm verlegt. Das reale Programmziel von ARD und ZDF, hohe Quoten zu erzielen, wird erreicht durch das Senden von »kommerziellem Süßstoff«, wie der Filmregisseur Dominik Graf es nennt. Die Devise laute: »Bloß weg von allen Bildungsaufträgen, weit fort mit allen kulturellen Vorreiterfunktionen, so übertrieben, daß man eine Neurose vermuten würde« (Graf). 25Drehbuchautor Wolfgang Menge sagte bereits 1989 bei einer Grimme-Preis-Verleihung: »Würden Sie beispielsweise die Lebensfähigkeit unserer Demokratie daran messen, welche Fernsehprogramme die höchsten Einschaltquoten erreichen, wäre es höchste Zeit, unser Wahlsystem zu ändern.« 26
Günter Gaus ist heute vielen nur noch als Politiker bekannt, 27war aber durch seine Sendereihen Zur Person oder Zu Protokoll berühmt geworden, die das ZDF seit 1963 ausstrahlte – kluge Gespräche, die Gaus mit Politikern, Wissenschaftlern oder Künstlern führte. Wenn man sich diese Sendungen heute ansieht, etwa die legendären Gespräche mit Hannah Arendt oder mit Rudi Dutschke, dann fällt neben der Intelligenz auch die Zurückhaltung auf, Gaus ist kaum je im Bild zu sehen. Welch eine Wohltat im Vergleich zu den sich ständig in den Mittelpunkt rückenden »Talkmastern« unserer Tage. Günter Gaus konstatierte schon im letzten Jahrhundert, daß das Fernsehen »als Aufklärungsmedium gescheitert« 28sei.
Ich halte nichts von Verschwörungstheorien, ich glaube daher nicht, daß die verantwortlichen Politiker, Medienkaufleute und Fernsehmacher, als sie in den achtziger Jahren die Einführung des Privatfernsehens in der BRD beschlossen, gezielt den Niedergang des Qualitätsfernsehens herbeiführen wollten. Man wird aber wohl sagen können, sie nahmen eine Nivellierung der Qualität billigend in Kauf. Diese Nivellierung ging einher mit einer neue Provinzialität (es war gewissermaßen »Helmut Kohl« statt »Helmut Schmidt«), die ihren perfekten symbolischen Ausdruck in der Serie Die Schwarzwaldklinik fand, die ab 1985 vom ZDF ausgestrahlt wurde. Die Sehnsucht nach Verständlichkeit, nach Wohltemperiertheit sollte endlich das kritische, engagierte Fernsehen ablösen, das in den siebziger Jahren noch eine starke Rolle gespielt hat. Es ging um eine »geistig-moralische Wende« auch im Fernsehen. Den Verantwortlichen ging es wahrscheinlich wie dem Zauberlehrling, zunächst riefen sie jubelnd die Geister, die sie dann nicht mehr loswurden, und wenn man heute ausgerechnet Politiker wie die Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hört, daß die öffentlich-rechtlichen Sender »sich angesichts ihres Auftrags nicht immer nur auf die Quote berufen« 29sollten, kann man eigentlich nur den Kopf schütteln angesichts des längst vollzogenen Qualitätsentzugs und der Entpolitisierung und Verdummung des Fernsehens seit den achtziger Jahren. Man hat munter vor sich hin gezündelt, und als das öffentlich-rechtliche Haus dann in Flammen stand, hat man verschämt beiseite geguckt, und niemand wollte je mit den Streichhölzern gespielt haben.
Kurios ist: Dem Niedergang des »Qualitätsfernsehens« steht eine Zuschauerzahl gegenüber, die noch nie so hoch war wie heute. Fernsehen erreicht in der BRD täglich knapp drei Viertel der gesamten Bevölkerung, und die durchschnittliche TV-Sehdauer lag 2013 bei 3 Stunden und 41 Minuten pro Tag. 30Natürlich ist die Sehdauer nicht unbedingt auch eine Verweildauer, das Fernsehen ist, wie bereits angedeutet, zunehmend ein »Nebenbeimedium«. Aber die durchschnittliche TV-Sehdauer entspricht fast zwei Monaten pro Jahr, nämlich mehr als 56 Tagen, und stieg seit der Einführung des Privatfernsehens drastisch an: Waren es 1980 noch 125 Minuten, sahen die Bundesbürger 1992 durchschnittlich bereits 158 Minuten, 1997 schon 183 und 2005 210 Minuten fern, und im Jahr 2011 wurde der bisherige Höchstwert von 225 Minuten erreicht, der 2013 geringfügig auf 221 sank – diese Zahl enthält alle Fernsehzuschauer ab 3 Jahren. Die Erwachsenen ab 14 Jahren (das ist das offizielle Kriterium der im staatlichen Auftrag tätigen Konsumforscher) 31sehen über 230 Minuten täglich fern (2010: 237, 2013: 231), Kinder von 3 bis 13 Jahren um die 90 Minuten (2000: 97, 2010: 93, 2013: 88). In Ostdeutschland wird deutlich mehr ferngesehen: 2013 waren es bei den Erwachsenen 271 Minuten, im Vergleich zu 220 Minuten bei den Westdeutschen. Und die Ostdeutschen bevorzugen die Privaten, RTL hat dort einen mehr als zwei Prozent höheren Marktanteil als das Erste, im Westen ist es genau andersherum. Und: je älter die Menschen, desto mehr sehen sie fern. Während die 60-69jährigen täglich weit über 5 Stunden, nämlich 317 Minuten fernsehen (mit +5,0% die höchste Steigerungsrate im Vergleich zu 2010), sind es bei den 30-39jährigen 195 (-10,1%) und bei den 20-29jährigen 148 (-8,6%) Minuten täglich; bei den unter 40jährigen nimmt also der Fernsehkonsum drastisch ab. 32
Besonders aufschlußreich werden diese Zahlen, wenn man sie nach soziologischen Kriterien betrachtet: Die Oberschicht beispielsweise sieht mit etwa 2 Stunden täglich am wenigsten fern und bevorzugt die öffentlich-rechtlichen Kanäle. Die Angehörigen der Unterschicht verbringen jeden Tag knapp 5 Stunden vor dem Fernsehgerät und sehen überproportional häufig Privatfernsehen. 33Wer das Abitur oder ein Studium abgeschlossen hat, sieht etwa 162 Minuten fern, wer einen Volksschulabschluß hat, 257 Minuten. Bei leitenden Angestellten, Freiberuflern und höheren Beamten sind es 168 Minuten, bei einfachen Arbeitern 250, und Arbeitslose sehen 319 Minuten täglich fern. Wer mehr als 4000 Euro netto verdient, sitzt im Schnitt 149 Minuten täglich vor der Glotze, wer es auf weniger als 1000 Euro netto bringt, 311 Minuten. Diese Zahlen korrespondieren im übrigen mit der sozialdemographischen Struktur der »Offliner«, also Personen ohne jegliche Online-Nutzung: Nur 6,1 Prozent aller Bundesbürger mit Abitur waren 2013 offline. Bei den Absolventen von Volks- oder Hauptschule waren es 40,4 Prozent. Und während nur 10,4 Prozent aller Berufstätigen offline waren, ist es die Hälfte aller »nicht Berufstätigen«, nämlich 49,8 Prozent. 34
Ohne Fernbedienung ist der gezielte Fernsehkonsum von zig Sendern mit Vollprogramm nicht mehr vorstellbar. War die Fernbedienung, dieses »direkt mit Faustkeil oder Zauberstab verwandte Zepter der Neuzeit« (József Tillmann), mit dem sich jeder Mensch in seinem Fernsehsessel auf dem Gipfel seiner Macht fühlen kann, bei ihrer Einführung vor sechzig Jahren noch purer Luxus, ist sie heute existentielles, nicht mehr wegzudenkendes Utensil. Die Fernsehzuschauer setzen sich nicht mehr gezielt vor das Fernsehgerät, um eine bestimmte Sendung zu sehen, sondern um ein bißchen herumzuzappen. Und je dröger das Programm, desto mehr wird gezappt, und wenn man auf seinen vierzig oder fünfzig Sendern nichts Brauchbares gefunden hat – »57 Channels (And Nothin’ On)« singt Bruce Springsteen –, beginnt man eben wieder von vorn. Die Fernbedienung ermöglicht dem Zuschauer, wenn man es positiv formulieren will, als »Flaneur« durch das Bilder-Universum des Fernsehens zu wandeln.
In aller Regel wird der Zuschauer jedoch eher die Häppchen des Fast-Food-TVs zu sich nehmen, die ihn ähnlich unbefriedigt zurücklassen wie das Fast Food der einschlägigen Frikadellenbratketten. Die »Müdigkeitsgesellschaft«, von der Byun-Chul Han spricht, setzt sich beim Fernsehkonsum fort. Die Couch-Potatoes fühlen sich mit der Fernbedienung in ihrer Hand als mächtige Akteure ihrer eigenen Schaltzentrale, sind aber doch nur konsumierende Objekte der bereitstehenden privaten oder öffentlich-rechtlichen Verblödungsmaschinerie.
Читать дальше