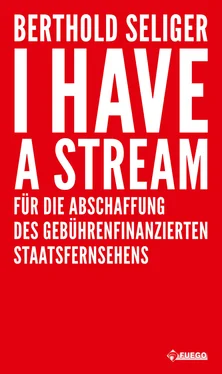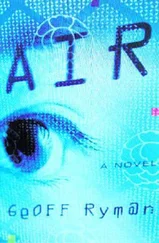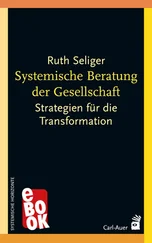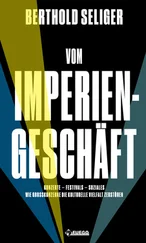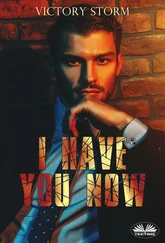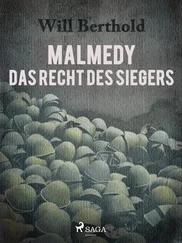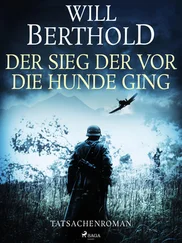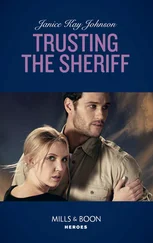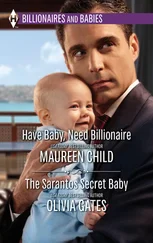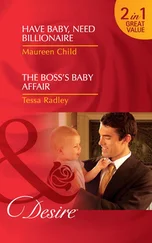All die wohlmeinenden, bildungsbürgerlichen oder feuilletonistischen Forderungen nach einem »besseren Programm« greifen zu kurz. Der Fehler liegt im System und ist unter den herrschenden Bedingungen irreversibel. Der ultimative Sog des bräsigen Staatsfernsehens besteht darin, uns zu einer genügsamen, unkritischen und das Vorhandene als geradezu gottgegeben 11akzeptierenden Zuschauermasse zu formen.
Dabei gibt es längst Alternativen, die das Staatsfernsehen zu einem Auslaufmodell machen, das sein Technikmonopol verloren hat. Wir können Filme oder Sportübertragungen im Privat- oder Bezahlfernsehen angucken. Wir können für relativ wenig Geld zigtausend Filme dann, wann wir es wollen, und dort, wo wir es wollen, betrachten. Und wir haben das Internet mit seinen vielfältigen Informationsmöglichkeiten und mit Kanälen wie YouTube, auf denen wir nicht einseitig konsumieren, sondern uns selber einbringen, eben nicht nur empfangen, sondern auch senden können. YouTube erreicht selbst in Deutschland längst deutlich mehr junge Menschen als alle hochsubventionierten Programme des Staatsfernsehens. Letzteres reagiert in denkbar hilflosester Weise: »Deppen mit Kamera« lautete die Überschrift eines Beitrags der Tagesschau zum zehnjährigen Jubiläum von YouTube im Februar 2015.
Die Fernseh-Oberen von ARD und ZDF leben in ihrem eigenen, idyllischen und selbstgefälligen System, in einer Art Lummerland der sechziger Jahre. »Eine Insel mit zwei Bergen und im tiefen, weiten Meer« hieß es in dem Lied der Augsburger Puppenkiste , und die Leute vom Staatsfernsehen mögen annehmen, daß mit den zwei Bergen auf dem »schönen Lummerland« eben das Erste und das Zweite gemeint sind. Doch sie leben auf einer Insel weit entfernt von der Realität (und darüber hinaus ist die Insel im Puppenspiel ja auch nur »ungefähr doppelt so groß wie unsere Wohnung«). Im wahren Leben, in unserer Zeit wissen die Menschen: Staatsfernsehen ist kaputtes YouTube. Fernsehen vergeudet unser Leben.
Wir sind gekommen, um nein zu sagen.
Kindheit in der Bundesrepublik Deutschland in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts, das war bei dem Teil der Bevölkerung, der überhaupt schon ein Fernsehgerät im Wohnzimmer stehen hatte, Schwarzweißfernsehen, das waren Lassie , Flipper und Rin Tin Tin , also amerikanische TV-Serien, in denen Tiere im Mittelpunkt standen. Fernsehen in den 60er Jahren, das war etwa das Ritual, am 1. Januar das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker zu sehen, eine Tradition, die 1939 für Adolf Hitlers »Kriegswinterhilfswerk« begonnen und 1941 zugunsten der NS-Organisation »Kraft durch Freude« fortgeführt wurde und nicht zuletzt der Vereinnahmung des »Walzerkönigs« Johann Strauss durch die Nationalsozialisten sowie dem NS-Konzept einer gezielten Unterhaltungs-Propaganda diente. Seit 1959 wird das Neujahrskonzert vom ORF weltweit live im Fernsehen übertragen, und es gelang, dieses Konzert zu einem globalen Ereignis, einem Event zu modellieren, und so war das Neujahrskonzert selbst für nicht besonders musikaffine Menschen ein alljährlicher Pflichttermin (gefolgt von der Übertragung des Neujahrs-Skispringens aus Garmisch-Partenkirchen).
Fernsehen in den sechziger Jahren, das waren Übertragungen aus den Apollo-Raumschiffen, die die Erde umkreisten (der ohne jede Hilfe aufrecht stehende Stift AG7 mit seiner versiegelten Patrone in einer Schalte aus dem Apollo-7-Raumschiff!), und später natürlich die Mondlandung.
Fernsehen in den sechziger Jahren, das war die Zuteilung von Fernsehminuten durch die Eltern, das war das Testbild, das in den vielen sendefreien Stunden ausgestrahlt wurde. Und der »Schnee« mitsamt Rauschen, wenn nicht einmal mehr das Testbild gesendet wurde: Noch Anfang der fünfziger Jahre strahlte das »Deutsche Fernsehen« (später ARD, heute »Das Erste«), das das einzige Programm war, nur drei Stunden täglich aus. Ende der Fünfziger waren es pro Tag fünf Stunden, und die Fernsehverantwortlichen verstanden ihr Medium hauptsächlich als eines der Bildung, das nur zu einem geringen Teil auch unterhalten sollte. Live-Übertragungen waren sehr selten und für die Zuschauer besonders spektakulär, wie etwa die Krönung Elisabeths II. 1953 oder die Fußball-Weltmeisterschaft 1954. Bereits damals kamen die besonderen Fernseh-Events also aus den Bereichen »Adel« und »Sport«. Allerdings konnten diese »Spektakel« damals nur wenige Menschen verfolgen, denn kaum jemand hatte bereits einen privaten Fernsehanschluß. Die in den fünfziger Jahren gebräuchlichen Fernsehtruhen waren ein Statussymbol der Wohlhabenden und unerschwinglich für den Durchschnittsverdiener.
1960 mußte man für einen Schwarzweißfernseher in der Bundesrepublik im Schnitt über 351 Stunden arbeiten, im Jahr 2009 waren es für einen 81-cm-Full-HD-Flachbildfernseher nur noch 35½ Stunden. 12Anfang der sechziger Jahre verfügten nur 34 Prozent aller bundesdeutschen Haushalte über ein Fernsehgerät, und nur 13 Prozent aller Haushalte konnten sich sowohl einen Kühlschrank als auch einen Fernseher und eine Waschmaschine leisten, während 2013 diese drei Geräte in 90 Prozent aller deutschen Haushalte zur Standardausstattung gehören, und 95 Prozent aller Haushalte verfügen heute über ein Fernsehgerät – das Fernsehen ist damit, gleich hinter dem Kühlschrank, das zweithäufigste Gebrauchsgut in deutschen Haushalten (noch vor Waschmaschine und Telefon). 13Seit den sechziger Jahren bis Mitte der siebziger Jahre wuchs die Zahl der Haushalte mit einem Fernsehgerät jährlich um 1,1 bis 1,4 Millionen, und der Ausstattungsgrad der Haushalte mit Fernsehern wuchs von 34,4 Prozent 1962 über 72,7 Prozent 1969 und 87,2 Prozent 1973 auf 93,2 Prozent 1978, also ungefähr die Zahl, die auch heute noch besteht. 14Wobei heute nicht nur über 95 Prozent aller Haushalte einen Fernseher haben, sondern auch 28 Prozent zwei Fernseher besitzen, und zusätzlich 11 Prozent gar mehr als zwei.
In den sechziger Jahren begann das Programm der ARD um 17 Uhr mit kurzen Kindersendungen, zwischen 18 und 20 Uhr folgten Regionalprogramme. Mit der Tagesschau um 20 Uhr begann das Abendprogramm – meistens zwei Beiträge, etwa eine Komödie gefolgt von einem Fernsehballett. Und wo es einen Sendebeginn gab (eingeleitet dadurch, daß das Testbild ein paar Minuten vor Programmbeginn durch eine Uhr ersetzt wurde, deren Sekundenzeiger die Kinder, die auf ihre Sendungen warteten, gebannt verfolgen konnten), gab es naturgemäß auch einen Sendeschluß, der meistens 23 Uhr war, selten später. Das ZDF zeigte ein ähnliches Programm: Es begann ein- bis zweimal (ab 1969) wöchentlich mit Mosaik , dem »Magazin für die ältere Generation«, mit Gymnastikübungen, Anleitungen zu Stick- und Knüpfarbeiten, Berichten über Seniorenausflüge und dergleichen mehr. Die Sendung wurde 1991 eingestellt, ein separates Seniorenmagazin wurde im ZDF, dem Sender mit dem Zuschauer-Altersdurchschnitt von über 60 Jahren, offensichtlich nicht mehr benötigt, denn sein Programm ist heute sozusagen komplett gerentokratisch.
Wer eine Fernsehsehsendung verpaßte, hatte Pech gehabt, es gab noch keine Rekorder, mit denen man Sendungen hätte aufzeichnen können, es galt, pünktlich vor dem Fernsehgerät zu sitzen und dabei zu sein . Die Hoheit über den Zeitplan der Zuschauer hatten die Programmacher. Hier findet sich der Grundgedanke, dem die Fernsehverantwortlichen auch heute noch nachhängen: Fernsehen als Teil des Räderwerks einer panoptischen Maschine, um es mit Foucault zu sagen, die wir als Beitragszahler wie als Zuschauer, »eingeschlossen in das Räderwerk, selbst in Gang halten – jeder ein Rädchen«. 15
Mit dem wachsenden Ausstattungsgrad an Fernsehgeräten in den frühen siebziger Jahren wuchs auch das Fernsehprogramm. Die Dritten Programme wurden bereits in der zweiten Hälfte der Sechziger gestartet (der Bayerische Rundfunk begann 1964, das Jahr darauf folgten NDR, RB, SFB, WDR und 1969 dann SDR, SR, SWF), waren aber jahrelang hauptsächlich Bildungs- und Kultursender, es liefen Sendungen des Schulfunks, Sprachsendungen und einige Regionalprogramme. Noch 1973 startete das ARD-Programm werktags um 16.15 Uhr und endete zwischen 23 und 24 Uhr. Das ZDF strahlte von 16.30 oder 17.00 Uhr bis zur letzten Stunde des Tages aus. Vormittags unterbrachen höchstens gelegentliche Bundestagsdebatten ( Heute im Parlament ) das Testbild. Ende der siebziger Jahre wurde das ARD-Programm aus aktuellem Anlaß auch schon mal bis nach Mitternacht ausgedehnt (zum Beispiel am 15. 2. 1979: Zum Tode von Jean Renoir: Die goldene Karosse , bis 0.35 Uhr), aber erst seit dem 2. Januar 1981 wurde von ARD und ZDF ein flächendeckendes Vormittagsprogramm ausgestrahlt. Gesendet wurden hauptsächlich Wiederholungen des Vorabends – ein »Schichtarbeiterprogramm«. Von 1989 an beendete das gemeinsam von ARD und ZDF im wöchentlichen Wechsel produzierte Mittagsmagazin das Vormittagsprogramm. Im Sommer 1992 kam das nach den gleichen Kriterien produzierte Morgenmagazin hinzu als Antwort auf das von den großen Privatsendern RTL und Sat.1 längst ausgestrahlte »Frühstücksfernsehen«. Man kann sich das heute kaum mehr vorstellen, aber erst in den neunziger Jahren erfolgte die Fernseh-Dauerberieselung rund um die Uhr, wie wir sie heute als selbstverständlich kennen und hinnehmen: RTL und Sat.1 erreichten 1992 als erste Sender eine 24-Stunden-Vollversorgung, das Erste und ZDF zogen später nach. Noch 1991 betrug die tägliche Sendeleistung des Ersten 11,2 Stunden und die des ZDF 13,7 Stunden. 16
Читать дальше