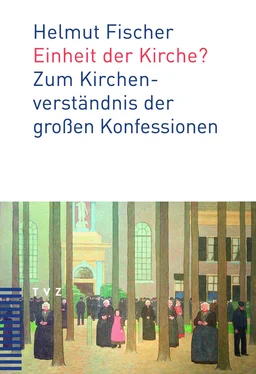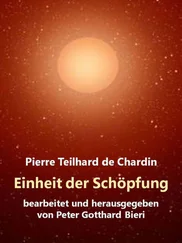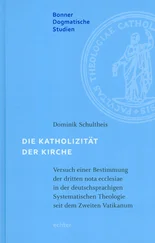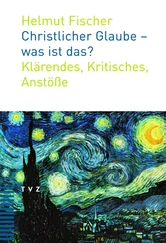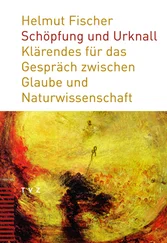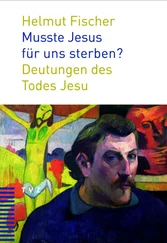Die synoptischen Evangelien (Matthäus, Markus,. Lukas) berichten, dass Jesus zwölf Apostel berufen hat, deren Namen – mit kleinen Abweichungen – auch genannt werden. Der älteste dieser Texte liegt in Mk 3,13–19 vor: »Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er um sich haben wollte; und sie traten zu ihm hin. Und er bestimmte zwölf, die er auch Apostel nannte, die mit ihm sein sollten und die er aussenden wollte, zu verkündigen und mit Vollmacht die Dämonen auszutreiben. Und er bestimmte die Zwölf: Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, denen er den Beinamen Boanerges gab, das heißt ‹Donnersöhne›, und Andreas und Philippus und Bartolomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alfäus, und Thaddeus und Simon Kananäus, und Judas Iskariot, der ihn dann auslieferte.«
Umstritten ist, ob dieser Text einen historischen Vorgang wiedergibt. Plausibel ist die Einsetzung der »Zwölf« hingegen als Zeichenhandlung, mit der zum Ausdruck gebracht wird, |20| dass Jesu Verkündigung darauf zielt, ganz Israel (repräsentiert durch die zwölf Stämme) als das endzeitliche Volk Gottes zu sammeln. Historisch hatte dieser Zwölferkreis wohl keine langfristige Bedeutung. Als Paulus nach seinem Damaskuserlebnis Jerusalem etwa im Jahre 35 erstmals besuchte, verhandelte er nach Gal 1,18f mit den »Aposteln« Petrus und Jakobus, dem Bruder Jesu, der aber nicht zu dem Zwölferkreis gehörte. Der Zwölferkreis verlor bald nach Jesu Tod seine Bedeutung, schon deshalb, weil mit der Heidenmission die Christusbotschaft über Israel hinausdrängte.
2.2.6 Der Charakter der Jerusalemer Urgemeinde
In der Urgemeinde in Jerusalem war eine besondere Organisation zunächst nicht erforderlich, weil sie sich noch im Verband der Synagoge befand. Einer konkreten Struktur bedurfte sie erst dann, als sie sich vom Tempel und der Synagoge löste und als eigenständige Gemeinschaft formierte. In Anlehnung an den jüdischen Ältestenrat bildete man wohl ebenfalls einen Leiterkreis, dessen Sprecher Petrus war. Ob der Kreis der Zwölf dabei noch eine Rolle spielte, ist nicht mehr zu ermitteln. Da sich Petrus wegen seiner Missionstätigkeit unter Juden nur noch selten in Jerusalem aufhielt, übernahm der Herrenbruder Jakobus die Leitung der Gemeinde. Unter seinem Einfluss erhielten die jüdischen Traditionen wieder größeres Gewicht, und das Ältestenamt nahm deutlichere Gestalt als Hüteramt hinsichtlich der Tradition an.
Von einer Besonderheit der Jerusalemer Urgemeinde berichtet Apg 6,1–6. Danach wurde ein Kreis von sieben Personen eingerichtet, der sich der Belange und der sozialen Probleme jener hellenistischen Judenchristen annahm, die in Jerusalem wohnten. Diese Griechisch sprechenden Judenchristen, die nicht am synagogalen und kultischen Leben des Tempels teilnahmen und auch die jüdischen Ritualgesetze nicht einhielten, bildeten wohl schon sehr früh eine eigenständige Gruppe |21| innerhalb der Urgemeinde. Ihr Sprecher, Stephanus, wurde wegen seiner Christusbotschaft und seiner gesetzeskritischen öffentlichen Äußerungen vor der Stadt gesteinigt. In der Apostelgeschichte heißt es dazu: »Und die Zeugen legten ihre Kleider ab, zu Füßen eines jungen Mannes namens Saulus. … Saulus war einverstanden mit dieser Hinrichtung« (Apg 7,58 und 8,1). Daraus ist zu schließen, dass Stephanus unter den Augen des Saulus/Paulus zwischen 30 und 33 wegen seines Christuszeugnisses als der erste Märtyrer der Christenheit zu Tode gebracht wurde.
2.2.7 Die judenchristlichen Gemeinden im syrisch-palästinensischem Raum
Das Zentrum des hellenistischen Judenchristentums der ersten Zeit lag in Antiochia in Syrien, der damals drittgrößten Stadt im Römischen Reich nach Rom und Alexandria. Die Gemeinden in und um Antiochia waren bereits zu Beginn der 30er Jahre von wandernden Charismatikern gegründet worden. In den ländlichen Gemeinden dieser Gegend gab es bis in das 2. Jahrhundert keine erkennbaren Organisationsstrukturen und wohl auch keine örtlichen Leitungsgremien. Das Matthäusevangelium, das zwischen 80 und 100 im syrischen Raum entstanden ist, kennt weder Älteste noch Episkopen, und selbst von Aposteln ist (sieht man von der Berufung der Zwölf ab) nicht die Rede. Auch das Johannesevangelium (zwischen 100 und 125), das ebenfalls aus Syrien stammt, erwähnt diese Bezeichnungen nicht. Ortsfeste Strukturen für bestimmte Dienste beginnen sich zuerst in städtischen Gemeinden herauszubilden.
2.2.8 Gemeinden im Einflussbereich des Paulus
Paulus wusste sich von seiner Christusvision von Damaskus im Jahr 33 zum »Apostel des Herrn« berufen und dadurch auserwählt und ausgesandt, seinen Namen und seine Botschaft unter den Völkern zu verbreiten. An die Galater schrieb er, dass |22| es Gott »gefiel, mir seinen Sohn zu offenbaren, dass ich ihn unter den Völkern verkündige« (Gal 1,15). Paulus verstand seine Berufung so, wie es Jesus seinen Jüngern gegenüber ausgedrückt hatte: »Wer unter euch groß sein will, sei euer Diener, und wer unter euch der Erste sein will, sei der Knecht aller. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele« (Mk 10,43–45).
Von diesem Verständnis seiner Berufung zum Zeugendienst her hat es Paulus auch als die Aufgabe der Gemeinde und eines jeden Christen betrachtet, die Christusbotschaft durch das eigene Leben vor aller Welt zu bezeugen und in die Welt hinauszutragen. Dieser Dienst erledigt sich nicht spontan und von allein, sondern er muss geordnet geschehen, und zwar sowohl innerhalb der Gemeinde als auch im Wirken nach außen. Dabei geht es nicht darum, Ämter zu verteilen, sondern die Geistesgaben (Charismen) der Einzelnen so einzusetzen, das sie dem Aufbau der Gemeinde und deren Zeugnis vor der Welt dienen.
Was mit »Charisma« gemeint ist, deutet Paulus in 1Kor 12,8–10 an. Er nennt Weisheitsrede, Erkenntnisrede, prophetische Rede, Zungenrede und die Fähigkeit, diese zu übersetzen, sowie Unterscheidung der Geister und Gabe der Heilung. Jeder Getaufte hat danach eine Gabe, die er für das Leben und das Zeugnis in die Gemeinde einbringen kann. Insofern ist jeder seiner Gabe gemäß zum Zeugen- oder Aposteldienst berufen. Es geht dabei nicht um Selbstdarstellung, nicht um Macht und nicht um Ansehen. Denn: »Die uns zugeteilten Gaben sind verschieden, der Geist jedoch ist derselbe. Die Dienste sind verschieden, der Herr aber ist derselbe. Das Wirken der Kraft ist verschieden, Gott jedoch ist derselbe, der alles in allen wirkt. Jedem wird die Offenbarung des Geistes so zuteil, dass es allen zugutekommt« (1Kor 12,4–7).
Innerhalb dieser verschiedenen Dienstfunktionen gibt es |23| keine verschiedenen Grade der Würde. »Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, die Glieder aber nicht alle dieselbe Aufgabe erfüllen, so sind wir, die vielen, in Christus ein Leib, im Verhältnis zueinander aber Glieder« (Röm 12,4f). Prophetisch reden, lehren, trösten, heilen, einfache Hilfsdienste leisten, Almosen geben, leiten u. a. sind gleich wichtig und gleich wertvoll. Weder jeder noch einer allein muss alles beherrschen und tun. Bei Paulus ist noch keinerlei Tendenz zu festen Gemeindeämtern erkennbar. Als nicht geschichtlich kann die Notiz in Apg 14,23 gelten, wonach Paulus in jeder seiner Gemeinden Älteste eingesetzt hat.
2.2.9 Die kirchlichen Ämter
Bezeichnungen wie »Lehrer«, »Älteste«, »Diakone«, »Bischöfe« werden im heutigen Sprachgebrauch der Kirchen als theologisch und rechtlich geordnete Ämter verstanden, die nur in offiziellem Auftrag wahrgenommen werden dürfen. Derartige Ämter gab es in den beiden ersten Christengenerationen nicht.
In den von Charismatikern gegründeten Gemeinden lagen feste Ämter außerhalb des Denkbaren. In den paulinischen Gemeinden kannte man Evangelisten, Hirten, Apostel, Propheten und andere Charismen. Man bezeichnete damit Funktionen, die in ihren Schwerpunkten zunächst noch nicht festgelegt waren, sondern nach den örtlichen Gegebenheiten mit konkreten Aufgaben verbunden wurden. In den palästinensischen Gemeinden nahm zuerst die Funktion der Ältesten (Presbyter) als Leitungsgremium der Gemeinde deutlichere Konturen an. In jenen vier Textstellen, die im Neuen Testament von Bischöfen sprechen, werden diese in ihrer Funktion als Aufsichtführende mit den Presbytern gleichgesetzt oder ihnen zugeordnet.
Читать дальше