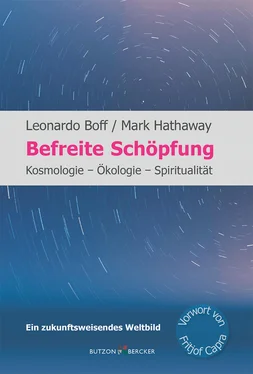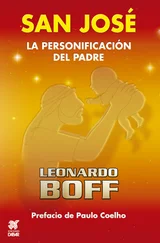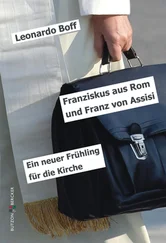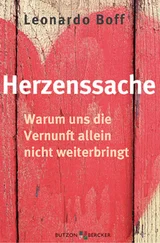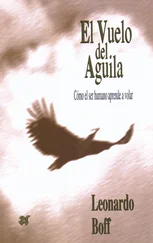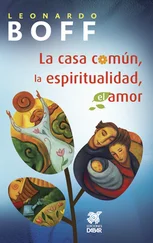Heute ist Wachstum gleichbedeutend mit wirtschaftlicher Gesundheit geworden. Wenn das Wachstum stagniert oder, schlimmer noch, wenn die Wirtschaft „schrumpft“, dann befinden wir uns in der Rezession, und darauf folgen mit Sicherheit Arbeitslosigkeit und andere soziale Missstände. Nur wenige von uns stellen die alte Weisheit infrage, die die Notwendigkeit einer sich immer weiter ausdehnenden Ökonomie behauptet.
Doch wirtschaftliches Wachstum im herkömmlichen Sinn bedeutet den Verbrauch von mehr natürlichen Ressourcen und die Produktion von mehr gefährlichen Nebenprodukten wie chemische und nukleare Abfälle. Dabei unterliegen, wie wir bereits gesehen haben, viele wesentliche Rohstoffe für eine wachsende Wirtschaft einem rasch fortschreitenden Prozess der Erschöpfung. Obwohl einige „Optimisten“ davon ausgehen, dass man hierfür synthetische Ersatzstoffe finden wird, gibt es wenige oder kaum Anzeichen dafür, dass diese Hoffnung begründet wäre.
Die Crux dieser Angelegenheit besteht darin, dass der Planet, auf dem wir leben, endlich ist. Es gibt nur eine bestimmte Menge an sauberer Luft, trinkbarem Wasser und fruchtbarem Boden. Auch die Menge an verfügbarer Energie ist begrenzt (sie wird durch die Sonne erneuert, aber in einem festgelegten Maß). Da alle Ökonomien und alle Menschen Anspruch auf diese begrenzten wesentlichen Voraussetzungen erheben, liegt es klar zutage, dass es Grenzen des Wachstums gibt.
Warum aber beharren die meisten Wirtschaftswissenschaftler weiterhin darauf, dass ein grenzenloses, undifferenziertes Wachstum der Wirtschaft sowohl nötig als auch gut sei? Teilweise ist dieser Glaube auf eine Verwechslung von Wachstum und Entwicklung zurückzuführen. Herman Daly stellt klar: „Wachsen heißt an Größe zunehmen durch Einverleibung oder Hinzufügung von Material, während entwickeln meint, die Möglichkeiten zu erweitern oder zu verwirklichen, in einen reichhaltigeren, großartigeren, besseren Zustand zu bringen.“ (1996, 2) Unsere Wirtschaft muss in diesem qualitativen Sinne, aber nicht unbedingt quantitativ wachsen. Tatsächlich „entwickelt sich unser Planet im Lauf der Zeit, ohne zu wachsen. Unsere Wirtschaft, ein Subsystem dieser endlichen, nicht-wachsenden Erde, muss ein ähnliches Entwicklungsmuster übernehmen“ (1996, 2).
In früherer Zeit, als die Menschen eine relativ kleine Population auf der Erde darstellten und unsere Techniken relativ einfach waren, waren wir oftmals in der Lage, so zu handeln, als sei die Erde ein grenzenloses Rohmateriallager. Es ist wahr: Das Römische Reich, die Bewohner der Osterinsel, die Zivilisation der Maya im Tieflanddschungel und andere Kulturen richteten für die lokalen Ökosysteme schwere Schäden an und verursachten damit oftmals den Zusammenbruch ihrer eigenen Gesellschaften. Doch die Gesundheit des umfassenden globalen Ökosystems war niemals ernsthaft bedroht, und die lokalen Ökosysteme waren in der Lage, im Lauf der Zeit zu gesunden.
Heute hat die menschliche Population rasch zugenommen, und der Konsum der Menschen ist sogar noch weitaus schneller gewachsen. Von dem, was Daly eine Ökonomie der „leeren Welt“ nannte, sind wir zu dem übergegangen, was er als Ökonomie der „vollen Welt“ bezeichnet.
„Das wirtschaftliche Wachstum hat die Welt mit uns und unseren Dingen angefüllt, aber sie hat sie im Vergleich dazu der Dinge entleert, die vor uns da gewesen sind – was nun uns und unseren Dingen einverleibt ist, nämlich das natürliche System, welches das Leben erhält und das wir seit Kurzem in später Anerkennung seiner Nützlichkeit und Knappheit ‚natürliches Kapital‘ nennen. Eine weitere Expansion der ökologischen Nische des Menschen steigert nun oftmals die Kosten für die Umwelt schneller, als sie die Vorteile der Produktion vermehrt, und leitet damit eine neue Ära des antiökonomischen Wachstums ein […] eines Wachstums, das eher zur Verarmung als zur Bereicherung führt, da es unter dem Strich mehr kostet, als es wert ist. Dieses antiökonomische Wachstum macht es schwerer und nicht etwa leichter, die Armut zu besiegen und die Biosphäre zu schützen.“ (Daly 1996, 218)
Ein nicht nachhaltiger Pfad
Wir haben bereits eine Weise erwähnt, wie man die Wirtschaft der „vollen Welt“ verstehen kann: das Nettoprimärprodukt (NPP). Die Menschen verbrauchen nun über 40 % der Energie, die mittels Fotosynthese an Land erzeugt wird; 3 % werden direkt verbraucht, während der Rest schlicht verschwendet oder zerstört wird (durch Verstädterung, Entwaldung, Verschwendung von Feldfrüchten etc.) Der Anteil des verbrauchten NPP steigt noch weiter an, wenn wir die zerstörerischen Auswirkungen von Verschmutzung, globaler Erwärmung und Ausdünnung der Ozonschicht mit einbeziehen. (Meadwos et. al. 1992) Bei den derzeitigen Wachstumsraten werden wir um das Jahr 2030 80 % des NPP zu Lande für uns beanspruchen. (Korten 1995)
Ein anderer Zugang, um die Grenzen des Wachstums zu begreifen, ist die Vorstellung vom „ökologischen Fußabdruck“, wie sie William Rees und Mathias Wackernagel aus Britisch Kolumbien entwickelt haben. Ein ökologischer Fußabdruck basiert auf der Berechnung der Landfläche, die nötig ist, um die Lebensmittel, das Holz, das Papier und die Energie für einen Durchschnittsbewohner einer bestimmten Region oder eines Landes zu produzieren.
Während wir einen sehr kleinen Teil von 12 % der Landfläche der Erde nichtmenschlichen Arten überlassen (diese Größenordnung scheint schon fast auf skandalöse Weise gering zu sein), stehen jedem Menschen für seinen Unterhalt zurzeit 1,7 Hektar (bzw. 1,8 Hektar, wenn man auch die Meeresressourcen mit einbezieht) zur Verfügung. Doch der durchschnittliche Fußabdruck pro Person beträgt bereits 2,3 Hektar. 12Mit anderen Worten: Wir verbrauchen bereits 30 % mehr als das, was langfristig aufrechterhalten werden kann, und zwar vor allem aufgrund unseres Verbrauchs nichterneuerbarer Ressourcen. Wenn wir einen Anteil von 33 % des Landes anderen Lebewesen überließen – was eher der Vernunft entspräche ‒, dann hätte jede Person weniger als 1,3 Hektar zur Verfügung. Das bedeutet, dass wir in diesem Fall 75 % mehr konsumieren als das, was dem Kriterium der Nachhaltigkeit entspräche.
Oberflächlich betrachtet, könnte man daraus den Schluss ziehen, dass die Weltbevölkerung um mindestens ein Drittel reduziert werden müsste. Natürlich spielen die bloßen Zahlen eine Rolle, aber sie enthalten nicht die ganze Geschichte. Der Durchschnittsbewohner von Bangla Desh zum Beispiel hat einen ökologischen Fußabdruck von 0,6 Hektar, ein Peruaner braucht 1,3 Hektar. Die reichsten Nationen der Erde andererseits brauchen irgendetwas zwischen 5,4 Hektar (Österreich) und 12,2 Hektar (USA). Wenn jeder Erdenbewohner so viel bräuchte wie ein Bewohner des Nordens im Durchschnitt, dann würden wir mit etwa 7 Hektar pro Person ungefähr drei bis vier weitere mit der Erde vergleichbare Planeten benötigen, um unser Dasein zu erhalten. Es ist also klar, dass der übermäßige Konsum im Norden eine der Hauptursachen der ökologischen Bedrohung ist.
Ein weiterer Beleg für die Unmöglichkeit eines stetigen uneingeschränkten Wirtschafswachstums wird von einer ausgefeilten Computersimulation geliefert, wie sie die Autoren des Buches „Die Grenzen des Wachstums“ (Meadows et. al. 2006) benutzt haben. Wenn wir den derzeitigen Wachstumspfad in herkömmlicher Weise fortsetzen, ohne dabei größere politische Veränderungen vorzunehmen, werden unser materieller Lebensstandard und der menschliche Wohlstand kurz nach der ersten Dekade unseres Jahrhunderts dramatisch abnehmen – spätestens um 2025.
Je nach den unterschiedlichen Strategien und Szenarien, deren man sich bedient, kann der schnelle Niedergang des menschlichen Wohlstands hinausgezögert werden. Doch es ist verblüffend, dass selbst eine Verdoppelung der verfügbaren nichterneuerbaren Ressourcen einen relativ geringen Effekt hat. Nimmt man verbesserte Technologien in Verbindung mit einer größeren Verfügbarkeit von Ressourcen hinzu, dann verspricht dieses Szenario mehr Aussichten, den Kollaps zu vermeiden, obwohl sogar in diesem Fall die Lebenserwartung um die Mitte des Jahrhunderts zurückgeht. Doch dieses Szenario geht von den allerkühnsten optimistischen Annahmen aus: eine Verdoppelung der bekannten Ressourcen, eine effektive Kontrolle der Verschmutzung, deutlich höhere Ernteerträge, Schutz vor Bodenerosion und eine deutlich verbesserte Ressourcenproduktivität. Längerfristig (nach 2100) jedoch wird der Lebensstandard letztlich nicht mehr nachhaltig sein, da die Kosten steigen.
Читать дальше