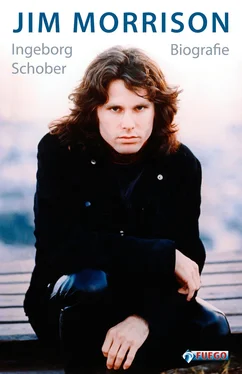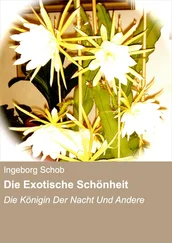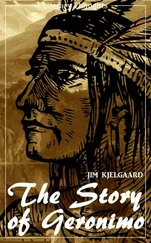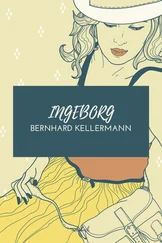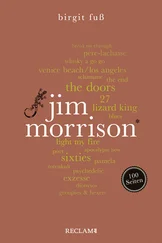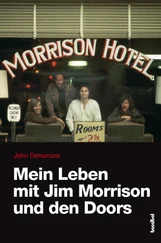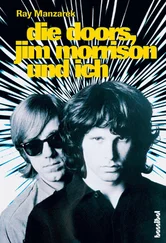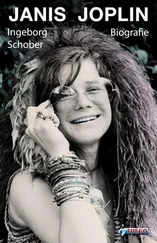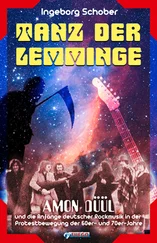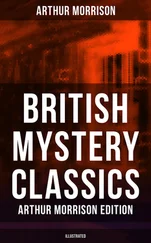Schon bald wird Jim zum Mittelpunkt einer exzentrischen Freundesclique. Dazu gehört Dennis Jakob, mit dem Jim am liebsten über Nietzsche und dessen Frühwerk ›Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik‹ philosophiert. Beide identifizieren sich mit dem griechischen Gott Dionysos und seinem rauschhaften, verzückten Leben. Als sie einmal in der Diskussion eine Zeile von William Blake _14zitieren - »Wären die Pforten der Wahrnehmung gereinigt, sähe der Mensch jedes Ding wie es in Wahrheit ist - unerschöpflich« denkt Jim zum ersten Mal darüber nach, eine Band namens The Doors zu gründen. Blakes Satz inspirierte später Aldous Huxley _15zu einem Buch über seine Meskalin-Erfahrungen, ›Die Pforten der Wahrnehmung‹, für Jim »Türen, die offen oder geschlossen sein können«.
Mit John DeBella, dem Sohn eines New Yorker Polizisten, entwickelt Jim die ›Theorie des wahren Gerüchts‹. Wahrheit? Wichtig ist, was die Leute glauben, und das sollte Jim später bei den Doors erfolgreich demonstrieren. Der attraktive Phil Oleno beschäftigt sich ausführlich mit dem Werk C. G. Jungs. Da Phils Vater Apotheker ist, hat er freien Zugang zu Drogen. Mit 34 Jahren ist Felix Venable der Älteste der Clique. Er hat eine schillernde Biografie und liebt den Alkohol und Pillen. Jim ist mit seinen 21 Jahren der Jüngste, aber was verrückte Ideen angeht, stehen die anderen ihm nicht nach. Wenn sie nicht darüber philosophieren, wie durch das Medium Film »Träume Realität werden«, wetten sie, wer in einer Stunde die meisten Bücher klauen kann, oder hören sich völlig bekifft im Musikarchiv Platten an. Jim beschmiert die Männertoilette der Uni mit obszönen Graffiti, klettert auf ein Campusgebäude und zieht sich aus, entblößt sich in einer öffentlichen Bibliothek und uriniert in Bücherregale. Er wird Stammgast in der Bar ›Lucky U‹, in der viele Veteranen verkehren, und verspottet betrunken die Rollstuhlfahrer. »Mit einem Image gibt's keine Gefahr«, schreibt er in sein Notizbuch.
Die Clique diskutiert die aberwitzigsten Filmideen, inspiriert durch ihr Interesse an der Psychoanalyse, die in den 60er Jahren in vielen Experimentalfilmen einen Boom erlebt: Schamanismus, Neurosen, Fetischisten, Abnormitäten, Nekrophilie, Masochismus und Sadismus. Die Studenten sollen von Anfang an kleine Übungsfilme drehen, um das Handwerk zu erlernen. Phil ist an einem Projekt der Psychologie-Klasse beteiligt, in dem ein nacktes Pärchen alle möglichen sexuellen Positionen einnimmt. Er besorgt Jim das Abfallmaterial, das dieser zu einer Szene mit einem sexuellen Höhepunkt montiert, die er mit Ravels ›Bolero‹ unterlegt. Außer den Studenten findet das niemand amüsant, die verärgerten Professoren geben Jim die schlechteste Note und stecken den ›Unruhestifter‹ in eine Sonderklasse für ›Problemfälle‹.
Statt Filme zu drehen, setzt sich Jim theoretisch mit dem Medium Film als Kunstform auseinander. In Hunderten von Notizen ringt er um die Definition des Films: »Die Kamera ist ein allsehender Gott, sie erfüllt das Verlangen nach Allwissenheit«, schreibt er, und »der Film ist die totalitärste Kunstform«, »ein Panoptikum, das auf seine technische Besamung wartet«. Für ihn sind Filme »Ansammlungen toter Bilder, die künstlich befruchtet werden«, die Zuschauer hingegen »heimliche Vampire«.
Das Kino kommt nicht von der Malerei her, von der Bildhauerei, von der Literatur oder gar - was naheliegt anzunehmen - vom Theater, sondern von der alten Jahrmarktsgaukelei, von der Magie. (...) Die ersten Instrumentarien waren Feuer, Rauch, Gifte und Glas.
1969 veröffentlichte Morrison diese Notizen im Selbstverlag in dem kleinen Gedichtband ›The Lords: Notes On Vision‹ der 1970 unter dem Titel ›The Lords And The New Creatures‹ - im amerikanischen Simon & Schuster-Verlag erschien.
Im Herbst 1964 ist Jims Vater wieder im Kriegseinsatz. Nordvietnamesische Schiffe sollen im Golf von Tonkin amerikanische Zerstörer angegriffen haben. Es ist der Vorabend des Vietnamkriegs und der weltweiten Studentenrevolten. Ende des Jahres nimmt Jims Vater seinen Abschied aus dem aktiven Marinedienst. Weihnachten trifft sich die ganze Familie an der Westküste, bevor Jims Vater im neuen Jahr nach London zum Oberkommando der US-Marine-Streitkräfte in Europa geht. Es ist das letzte Mal, dass Jim seine Eltern besucht.
Zurück an der UCLA fällt er vor allem durch angeberisches, großspuriges Benehmen, zunehmenden Drogenkonsum und obszöne Ausfälle auf. Einige Dozenten lassen ihn dennoch nicht fallen. Jims Lieblingsprofessor Ed Brokaw vermutet hinter Jims ›Dilettantismus‹ ein großes Talent: »Alles Destruktive zog ihn an«, meint er heute, »er roch es und wärmte sich die Hände an diesem Feuer.« Zum Abschluss des Semesters im Mai 1965 werden die Arbeiten der Studenten an zwei Tagen vorgeführt, um die Filme auszuwählen, die später öffentlich präsentiert werden sollen. Jims Klasse hatte die Aufgabe, einen Stummfilm zu drehen und diesen anschließend mit Geräuschen oder Musik zu unterlegen.
Sein Film entsteht ohne Drehbuch auf der Basis seiner Notizen. Heraus kommt eine zusammenhangslose Montage ohne eigentliche Handlung. John DeBella ist der Kameramann und Star von Jims Abschlussfilm. Er dreht in den schäbigen Bars im Vergnügungsviertel von Los Angeles und in Jims Appartement. Johns damalige Freundin, eine große deutsche Blondine, tanzt in Unterwäsche auf dem Fernseher, während Nazis über den Bildschirm marschieren. An der Zimmerwand hängen Playboy-Nackedeis, durchbohrt von Dartpfeilen. Jim hat einen Vorläufer der späteren Videoclips gedreht, wie sie Ende der 70er Jahre in der Musikszene in Mode kamen - allerdings ohne den dazugehörigen Song. Der Film hat keinen Titel und ist so schlampig montiert, dass sich die Klebestellen lösen. Nach der verspäteten Vorführung sind Jims Professoren enttäuscht und geben ihm nur ein ›Ausreichend‹.
Es ging um einen Filmemacher und das Auge des Filmemachers. Die Kamera und das Auge sahen all diese schrecklichen Sachen. Was der Filmemacher aufnahm, hatte solche Auswirkungen auf ihn, dass er schließlich eine Augenentzündung bekam. Dann hatte Jim nach einem Joint einen guten Einfall, und es folgte ein Schnitt auf die weiße Linie, die auf dem Bildschirm zu sehen ist, während der Fernseher ausgeschaltet wird, und die auf einen winzigen Punkt schrumpft. Irgendwie war das stark, aber ich würde nicht sage, dass es ein guter Film war.
Der Mitstudent John DeBella über Jims Abschlussfilm
Professor Terence McCartney Filgate, der in Jims Film mitgewirkt hat, hält seinen Studenten für unbeherrscht, aber außergewöhnlich. »Er machte auf Marlon Brando und war Frauen gegenüber sehr aggressiv.« Colin Young, ein anderer Dozent, meint: »Ich hatte nicht das Gefühl, dass Jim zu denen gehörte, die beim Film durchhalten. Meiner Meinung nach fehlte ihm die Geduld, sich lange genug mit Leuten herumzuschlagen, um einen Film zu machen. Er war ein Künstler, der seine Nummer noch nicht zusammenhatte. Ich fand seinen Film interessant, aber unfertig.« Er sollte in mehr als einer Hinsicht recht behalten. Jim ist über seinen Misserfolg so verbittert, dass er zwei Wochen vor Semesterschluss die UCLA verlässt. Gleichzeitig kommt es zum endgültigen Zerwürfnis mit Mary.
Ich sagte Jim, was für ein übles Zeug es war, wie es schmeckt und dass man hinterher drei Tage lang mit Leuten redet, die nicht da sind. Er sagte, »du hast mich überzeugt«, und fing an, das Zeug zu nehmen. Er füllte es in Kapseln und nahm ganze Hände voll auf einmal.
Jims Freund Phil Oleno über dessen Drogenexperimente
In diesen Tagen lassen sich in Los Angeles die jungen Leute bereitwillig und wahllos auf alles ein, was ihr Bewusstsein erweitert, und Jim schluckt und inhaliert, was er bekommen kann. »Er hätte alles ausprobiert«, so Phil Oleno, der aus der Apotheke seines Vaters das grüne Pulver Asthmador anschleppt, das aus dem giftigen Belladonna hergestellt wird. »Er musste herausfinden, wie es war.« Als Jim die UCLA verlässt, hat der neue amerikanische Präsident Lyndon B. Johnson Vietnam bereits den Krieg erklärt und die USA bombardieren das Land. Gleichzeitig kommt es in den amerikanischen Großstädten zu Rassenunruhen. Je mehr die politische Lage eskaliert, um so stärker erobert die neue psychedelisch und politisch gefärbte Rockmusik die Charts - ›Mr. Tambourine Man‹ von den Byrds, die Rolling Stones mit ›Satisfaction‹, die Beatles mit ›Help!‹ und Bob Dylan mit ›Like A Rolling Stone‹.
Читать дальше