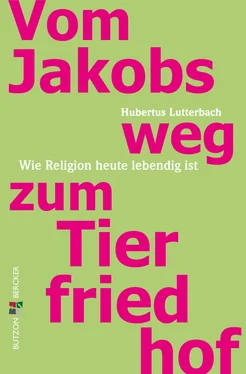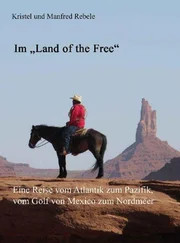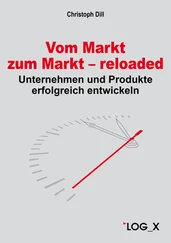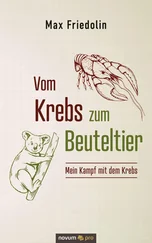Christliche Sakralorte und Pilgerschaft
Bekanntermaßen berichten die Evangelien, dass Jesus in seinem Erdenleben vielfältig umherzog und dass seine Anhänger ihn begleiteten. Unvorstellbar aber ist, dass Jesus eine christliche Wallfahrt angestoßen oder gar einen christlichen Pilgerweg initiiert hätte. Auch seine Jünger und Apostel richteten solche Gedenkstätten nicht ein.
In der Spur des Alten Testaments leiteten die frühen Christen jede Heiligkeit von der alles überstrahlenden Heiligkeit Gottes ab (Habakuk 1,12; Habakuk 3,3). Gemäß alttestamentlicher Überzeugung kann Gott auch „Menschen und Dingen, Orten und Zeiten“ Anteil an seiner Heiligkeit geben, sodass sie dadurch fortan aus der profanen Umgebung ausgesondert sind. 49Sogar eine Vermischung aus personen- und ortsgebundener Heiligkeit bezeugen die jüdischen Traditionen. Insofern seit der makkabäischen Verfolgung im 2. Jahrhundert v. Chr. die Blutzeugen und Märtyrer als besondere Freunde Gottes galten, wurden auch ihre Gräber geehrt und als Kraftquellen wertgeschätzt: „Die Wirkkraft des verstorbenen Gerechten geht von seinem Grabe aus, und deshalb werden die Heiligengräber von den Juden der jesuanischen Zeit hoch in Ehren gehalten.“ 50
In Abgrenzung vom Alten Testament überliefert das Neue Testament eine ortsunabhängige Vorstellung von Sakralität. Heiligkeit manifestiert sich in der Begegnung zwischen Gott und den Menschen ebenso wie im zwischenmenschlichen Kontakt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Matthäus 18,20) Von Gebäuden und ihren Einzelkomponenten sprechen die frühen Christen allenfalls metaphorisch, um das Miteinander zwischen Gott und den Menschen zu verdeutlichen: Christus als Eckstein, die Gläubigen als lebendige Steine, die Gemeinde als geistiges Haus (Epheser 2,20; 1 Petrus 2,5). Auch die Rede vom Christen als „Tempel des Heiligen Geistes“ gehört in diesen Bereich der bildhaften Rede (1 Korinther 6,19).
Tatsächlich machte das frühe Christentum als eine mobile Religion auf sich aufmerksam. Anstatt dass sich ihre Anhänger zu einem Haus Gottes begaben, vertrauten sie auf das Kommen Gottes in ihre Mitte: „In jedem Raum durfte und konnte sich die Gemeinde zur Eucharistie und zum Gebet versammeln.“ 51So zählt es zu den Besonderheiten der frühen christlichen Tradition, dass sie im Unterschied zur gesamten antiken Welt „keine christliche Sakralarchitektur“ hervorgebracht hat. 52Ebenso wenig kannte das früheste Christentum irgendwelche Kultgegenstände, weder heilige Bilder noch heilige Statuen. Die „christliche Ortlosigkeit“ 53wurzelte in der Überzeugung von Gottes „Allanwesenheit“ 54und machte nicht zuletzt jedwedes Wallfahrtswesen überflüssig.
Schon ab dem 2. Jahrhundert sollte sich das christliche Anfangsplädoyer zugunsten der Ortlosigkeit relativieren. So erhielt die Wertschätzung des Heiligengrabes ihren größten Schub durch die Verehrung der blutig gestorbenen christlichen Märtyrer. Aufgrund ihrer Überzeugungsstärke zu Lebzeiten galten sie auch über ihren Tod hinaus als „Orte“ göttlicher Präsenz.
Wie stellten sich die Christen die Anwesenheit Gottes im begrabenen Märtyrer und Heiligen genau vor? Maßgeblich war die bis weit über das Mittelalter hinaus leitende Vorstellung einer „Doppelexistenz des Heiligen im Himmel und auf Erden“. Man sieht den begrabenen Leib und die in den Himmel aufgefahrene Seele in einem „bleibenden Verbund“ 55. So gelten die Heiligen in ihren Gräbern als äußerst gotterfüllt und wirkmächtig, theologisch gesprochen: als „realpräsent“ 56. Die Annäherung an den heiligen Leib – mehr noch: die Berührung der Gebeine – vermittelt dem Menschen göttliche Kraft. Entsprechend dieser Vorstellung verwandeln sich alle Personen und Gegenstände, die mit einem solchen Grab in Kontakt kommen, indem sie diese göttliche Kraft in sich aufnehmen.
Auf die Dauer sollte sich im Christentum eine Mischung aus ortsbezogener und personaler Heiligkeit durchsetzen. Genau genommen beruhte die Wertschätzung der Pilger- oder Wallfahrtsorte darauf, dass man sich den dort in seinem Grab ruhenden Heiligen als einen mit göttlicher Kraft erfüllten Fortlebenden vorstellte. 57In diesen himmlisch garantierten Wirkmöglichkeiten und im Wunsch nach der unmittelbaren Begegnung mit dem Heiligen liegt der Ursprung all jener Wallfahrtsorte, die auf die Pilger bis heute ihre Anziehungskraft ausüben.
Von Anfang an galt die christliche Pilgerschaft als eine irdische Investition, von der sich der Pilger irdische Wohlfahrt und eine himmlische Gegenleistung versprach. Wer eine Pilgerschaft in Auftrag gab, setzte gleichfalls den beschriebenen Mechanismus in Gang: Er investierte von seinen materiellen Ressourcen in den „Mietpilger“, um sich mit dessen stellvertretender Pilgerschaft ein Anrecht auf Gottes Hilfe in Zeit und Ewigkeit zu sichern. Grundsätzlich orientierte sich der mittelalterliche Pilger an der „Gleichung“: Das Aufsuchen der Heiligengräber verspricht Heilung und Hilfe in aller Not, gewährt zudem Bußerlass und Verdienst vor Gott.
Die Wirkung des Heiligen konnte sich sowohl für den Pilger als auch für den Mietpilger vervielfachen, wenn er sich am (Begräbnis-)Ort des Heiligen genau an dessen Todes- oder Gedenktag aufhielt: „Im ganzen Mittelalter gestaltete die Person des Heiligen den ihr gehörigen Tag und strahlte eine besondere Heilskraft aus. Was immer an einem solchen Tag geschah, stand im Zeichen des Tagesheiligen.“ 58Im Hintergrund ist hier die religionsgeschichtliche Vorstellung maßgeblich, dass die Zeit in aller Regel nicht als gleichmäßig weiterfließend angesehen wird, sondern vielmehr als punktuell verdichtet und besetzt – entweder mit Heil oder mit Unheil. 59
Welche Gegenleistung suchten Pilger und Mietpilger am Grab des Heiligen? Als Erstes erbaten die Menschen des Mittelalters am heiligen Zielort ihrer Pilgerschaft ein Wunder: Von 1102 Wundern aus dem nordfranzösischen Bereich des hohen Mittelalters geschahen gut 40 Prozent direkt bei der Anrufung im Heiligtum bzw. nach Berührung der Reliquien. Beinahe ebenso viele ereigneten sich noch am gleichen Tag oder an den beiden folgenden Tagen. 60Angesichts des materiellen Mangels und der fehlenden medizinischen Versorgung, unter der die Bevölkerung zwischen 500 und 1500 litt, bezogen sich das gesamte Mittelalter hindurch die meisten Wunder am Pilgerort auf die Heilung körperlicher Gebrechen. – Als Zweites nahmen Menschen die Pilgerschaft persönlich oder durch einen Stellvertreter als Ausgleichsleistung für begangene Verfehlungen auf sich. Ebenso wie die irischen Bußbücher die Verbannung von der heimatlichen Insel als Sühneleistung für schwere Vergehen verlangt hatten, konnte hinter der zeitlich befristeten Übernahme der Heimatlosigkeit um der Pilgerschaft willen eine Sühnewallfahrt stehen. Zugleich verband man mit der Sühnewallfahrt die Hoffnung, dass der Heilige am Zielort dem Pilger weiter helfen möge, die ihm aufgetragene Bußleistung wirklich zu erfüllen. Im Verlauf des Mittelalters verbreitete sich sogar zunehmend die Sitte, schwere Delikte mit einer Wallfahrt zu den großen Heiligtümern zu bestrafen und so Haftstrafen zu ersetzen. 61
Das Pilgerandenken, das ein Pilger am Zielort erhielt – beispielsweise die Jakobsmuschel in Santiago de Compostela –, hatte im Mittelalter zeichenhaften Rechtscharakter. Im Diesseits schützte es den Pilger, wenn er es an der Krempe seines Pilgerhutes trug. Mit Blick auf das Jenseits gingen mittelalterliche Menschen davon aus, dass das Pilgerandenken im ewigen Gericht zu ihren Gunsten in die Waagschale fällt. Viele zeitgenössische Gerichtsdarstellungen belegen diesen Zusammenhang von Diesseitsinvestition und Jenseitsleistung. Entsprechend gab man das Pilgerzeichen einem Menschen bei seiner Bestattung mit ins Grab, damit er es im Jenseits als Beleg für seine gute Tat vorzeigen konnte. 62
Читать дальше