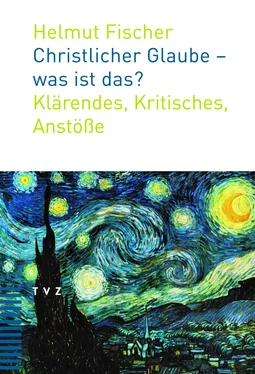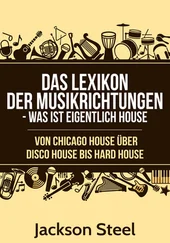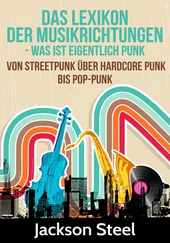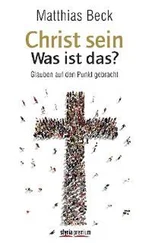1.4.2 Die Rolle der Religion in den frühen Kulturen
In der Frühzeit der Menschen und auch in den Naturreligionen bilden Kultur und Religion eine untrennbare Einheit. Wenn Religion die elementaren Sinnfragen des menschlichen Lebens stellt und darauf Antworten gibt, so repräsentiert sie das umgreifende Sinngefüge, von dem her die kulturelle Gemeinschaft ihr Sozialgefüge, ihr soziales Verhalten, ihr Verhältnis zur Natur ordnet und die Richtung ihrer kulturellen Entwicklung steuert.
In den regionalen Hochreligionen ist die Dominanz der Religion zwar noch gegeben, aber Religion und politische Herrschaft beginnen sich bereits als eigenständige kulturelle Bereiche zu profilieren. Herrscher und Priester ergänzen einander und bilden gelegentlich eine Personalunion. Das Irdisch-Weltliche bleibt aber im Nichtirdisch-Göttlichen verankert und auch darauf ausgerichtet. In den meisten islamischen Ländern ist die enge Verbindung von staatlicher Macht und Religion bis heute das Normale.
In den alten Kulturen äußert und präsentiert sich Religion öffentlich in der Gestalt von Kult. Das Wort »Kult« ist, wie auch »Kultur«, aus dem lateinischen colere hergeleitet und |30| bedeutet »hegen und pflegen«. Im Kult wird der Umgang mit dem Heiligen, den Göttern und dem Göttlichen in geordneter Weise gepflegt und in den Formen der Kultgemeinschaft vollzogen. Der Kult ist eine Art Begegnungs- und Vermittlungsstelle zwischen dem Irdischen und dem Göttlichen. Im Kult verehrt die Gemeinschaft zum einen die göttlichen Mächte, und sie empfängt darin zum anderen auch deren Segen und Bestätigung für ihr irdisches Handeln. Der Kult veranschaulicht und dokumentiert in den alten Kulturen die enge Verbindung zwischen Religion und Kultur. Er ist eine öffentliche Angelegenheit.
Die Nachklänge des Kultischen sind selbst in jenen Gesellschaften gegenwärtig, in denen Staat und Religion als streng getrennt gelten. Synagogen, christliche Kirchen und Moscheen prägen bis heute auch in säkularen Gesellschaften das Ortsbild. Jüdische, christliche und islamische Feste gliedern das säkulare Jahr und sind auch in jenen Ländern und Bevölkerungsschichten prägend gegenwärtig, in denen der Kontakt zu den religiösen Inhalten dieser Feste längst verlorengegangen ist. Weihnachten, Ostern und Pfingsten sind bei uns weithin von Inhalten überlagert worden, die mit ihren Ursprüngen nur noch wenig zu tun haben. Der säkulare Staat entwickelt für seine eigenen Anlässe der Repräsentation religionsartige Kultformen. Denken wir nur an die protokollarischen Riten beim Empfang von Staatsgästen und an die militärischen Zeremonien bei Paraden, Gedenkformen, Vereidigungen.
1.5 Religion und Staat
1.5.1 Die Alte Welt
Die Griechen hatten noch keine Bezeichnung für das, was wir »Religion« nennen. Sie trennten nicht zwischen einem sakralen und einem profanen Bereich, weil für sie noch alles Geschehen Anteil am Göttlichen hatte. Staatliches Handeln und |31| religiöser Kult bildeten eine Einheit, die im Kult zum Ausdruck kam. Im Alten Orient und auch im Alten Israel waren die Könige sakrale Gestalten. In Rom nahm Cäsar den sakralen Titel Pontifex Maximus für sich in Anspruch, das taten bis auf Gratian (375–383) auch die nachfolgenden römischen Kaiser. Im 5. Jahrhundert zog dann der römische Bischof in der Folge des Untergangs des römischen Reiches den Titel Pontifex Maximus an sich.
1.5.2 Die Einheit von Kirche und Staat bis ins 19. Jahrhundert
Die ersten Christengenerationen haben keinen neuen Kult eröffnet, denn sie erwarteten das Reich Gottes. Mit der staatlichen Macht setzten sie sich kaum auseinander. Als Anhänger einer nicht erlaubten Religion verhielten sich die Christen möglichst unauffällig und gegenüber der Staatsmacht loyal. Für sie galt: »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist« (Mk 12,17).
Kaiser Konstantin I. erhob mit dem Toleranzedikt von 313 das Christentum zur anerkannten Religion im römischen Reich. Kaiser Theodosius I. machte das Christentum 380 zur Staatsreligion. Kaiser Justinian I. (um 485 bis 565) verband Kirche und Staat zu einer Theokratie, die vom Kaiser geleitet wurde. In den orthodoxen Kirchen, besonders in Russland, ist das bis heute die Idealvorstellung.
Im Westen entwickelte sich seit Augustinus († 430) ein anderes Verhältnis der christlichen Kirche zum Staat, nämlich ein spannungsvolles Miteinander, Ineinander und Gegeneinander von kirchlicher und weltlicher Herrschaft. Papst Gelasius I. (492–496) postulierte die Zwei-Schwerter-Theorie. Danach ist die Kirche von der politischen Macht unabhängig. Zu Beginn des 2. Jahrtausends beanspruchte die Kirche den Vorrang vor der weltlichen Macht. Papst Gregor VII. erklärte im »Dictatus Papae« 1075 den Papst zum obersten Herrn der gesamten Erde. Papst Bonifatius VIII. geht noch weiter. In |32| der Bulle »Unam sanctam« von 1302 stellt er fest, dass die geistliche Macht jede irdische Macht überragt, und dass es für jedes menschliche Geschöpf heilsnotwendig sei, dem römischen Bischof unterworfen zu sein. Damit war der Bogen überspannt. Bereits 1309 gerieten die Päpste durch die französischen Könige in die »babylonische Gefangenschaft« von Avignon. Es gab jetzt zwei, später sogar drei Päpste nebeneinander, die einander und ihre Anhänger gegenseitig exkommunizierten. Für Jahrzehnte war die gesamte Christenheit exkommuniziert. Dieses abendländische Schisma wurde erst 1415 durch das Konzil von Konstanz beendet.
Durch die Reformation entstand eine neue Gesamtlage. Die Vorstellung von einem umfassenden christlichen Reich löste sich auf. Es bildeten sich souveräne nationale Territorialstaaten, die zunächst konfessionell geschlossen blieben, entweder römisch-katholisch oder protestantisch. Seit 1555 (Augsburger Religionsfriede) galt der Grundsatz: »cuius regio, eius religio«/der Herrscher bestimmt die Religion in seinem Herrschaftsbereich. Erst im Westfälischen Religionsfrieden, der den Dreißigjährigen Krieg beendete, wurde 1648 bestimmt, dass bei einem Konfessionswechsel des Landesherrn die Untertanen ihre Konfession behalten konnten. Das war ein wesentlicher Schritt auf dem beschwerlichen Weg zur Religionsfreiheit. Die Kirchen blieben allerdings weiterhin unter der Aufsicht der Landesherren. Die Glaubensfreiheit des Einzelnen kam in Deutschland erst durch die Französische Revolution von 1789 in Sicht und durch die Säkularisierung infolge des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803. Jetzt erst erhielten die Kirchen größere Eigenständigkeit, freilich noch nicht die volle Souveränität.
Das Ende des landesherrlichen Kirchenregiments brachte erst das Ende des Ersten Weltkriegs mit dem Ende der Monarchien im Jahre 1918. Kirche und Staat mussten sich jetzt |33| ganz neu definieren, und sie mussten auch ein neues Verhältnis zueinander finden.
1.5.3 Die Trennung von Kirche und Staat
1918 wurde ein Prozess abgeschlossen, der durch die Reformation eingeleitet worden war. Die Reformatoren haben den weltlichen Charakter der Welt betont. Ein Beispiel ist Luthers Wort zur Ehe. Er sagt: »Die Ehe ist ein weltlich Ding.« Die Naturwissenschaften begannen, die Welt »ohne die Hypothese Gott« zu verstehen. Auch die Lebensbereiche Wirtschaft, Politik, Medizin, Kunst u. a. lösten sich aus der Bevormundung durch die Religion.
Mit der Trennung von Staat und Kirche waren auch Religion und Staat als eigenständige Größen erkannt und anerkannt. Seither gibt es kein kirchliches Monopol mehr, die weltlichen Bereiche aus kirchlich-theologischer Perspektive zu deuten. Der Staat sieht sich als Organisation und in seinem Machtmonopol nicht mehr durch sakrale Quellen oder durch die Kirche legitimiert, sondern allein durch die Zustimmung seiner Bürger. Als den Bereich seiner Verantwortung betrachtet er nicht mehr Sittlichkeit, Moral oder Ordnung der Wahrheit, sondern den Rechtsfrieden und die Sicherheit für alle Bürger. Der säkulare Staat versteht sich religiös neutral und beschränkt sich auf innerweltliche Staatszwecke. Theokratische Elemente sind damit ausgeschlossen.
Читать дальше