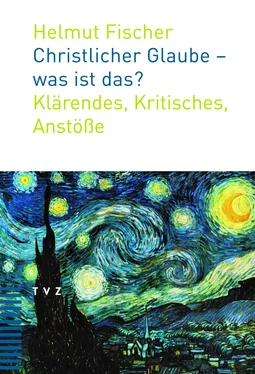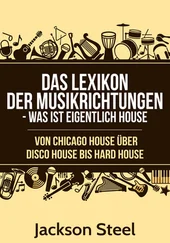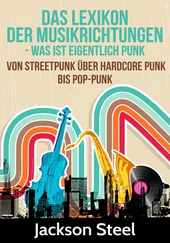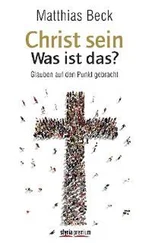1.2 Ausformungen von Religion
1.2.1 Religion äußert sich konkret
Religion setzt ein menschliches Wesen voraus, das sich seiner selbst und seines Seins in der Welt bewusst ist und auch weiß, dass es sterben wird. Das wiederum hängt von einem gewissen Niveau von sprachlichen Fähigkeiten ab. Wir wissen nicht, wann dieses Niveau in der Entwicklungsgeschichte des Menschen erreicht war. Wir wissen aber, dass sich Bewusstsein in Verhalten äußert. Es gibt Vermutungen, aber keine eindeutigen Beweise dafür, dass die Körperbemalung mit Pigmenten, die man bei 400 000 Jahre alten Skelettfunden festgestellt hat, auf religiöse Rituale hinweisen. Die Grabfunde ab 100 000 v. Chr., die auf bestimmte Bestattungsformen hinweisen, sind bereits eindeutige Zeugnisse religiösen Bewusstseins, auch wenn wir die Einzelheiten nicht zuverlässig deuten können. Bestattung Verstorbener in Ost-West-Richtung, in Hockstellung, mit Grabbeigaben und unter Hügeln zeigen |21| uns, dass der Tod als Zäsur erfasst und mit Gedanken über ein Danach verbunden wurde.
1.2.2 Religion äußert sich als Bewusstsein einer Gemeinschaft
Die regionale Einheitlichkeit von Bestattungsriten weist darauf hin, dass Religion nie die Sache Einzelner war, sondern sich von Beginn an als kollektives Bewusstsein von Gemeinschaften artikulierte. Daraus folgt: Es gibt die Religion genauso wenig wie es den Menschen gibt. Religion gibt es nicht abstrakt, sondern nur in Gestalt konkreter Ausformungen durch Gemeinschaften, Verbände, Stämme, Völker.
Das Bewusstsein des Menschen, in ein Größeres eingebunden zu sein, nennt der Philosoph Karl Jaspers zutreffend »das Umgreifende«. Religion als Verhältnis zu diesem Umgreifenden und für uns nicht Verfügbaren nimmt in jener Lebenswelt konkrete Gestalt an, in der sich eine Menschengruppe vorfindet. Jäger und Sammler sehen sich Mächten, Geistern oder Herren des Waldes gegenüber und erleben sich als von ihnen abhängig. Für Hirtenkulturen sind die Weiden und damit der Regen des Himmels für das Überleben wesentlich. Für sie ist der Himmel das Umgreifende. In agrarischen Kulturen begegnet jenes umfassend Größere dem Menschen in der Fruchtbarkeit der Mutter Erde, und der Regen des Himmels tritt als das männliche Prinzip hinzu.
1.2.3 Die Naturreligionen
Wir nennen die frühen Religionen mangels eines treffenderen Ausdrucks »Naturreligionen«. Sie haben noch keine heiligen Schriften, noch keine Berufspriester, sondern nur ein gemeinsames Verständnis ihrer Welt und jener Mächte, denen sie sich innerhalb der Gegebenheiten ihrer Lebenswelt gegenüber sehen. Diese Potenzen können als unpersönliche Kräfte, als Geister oder später auch als personifizierte Gestalten bis hin |22| zu überirdischen Göttern erlebt werden. Zu ihnen setzt sich die Gemeinschaft mit Ritualen in ein Verhältnis und in eine Verbindung, die auf Zusammenarbeit angelegt ist. Dabei spielen magische Praktiken und Opfer eine Rolle, mit deren Hilfe man auf diese Mächte einzuwirken versucht. Praktiken der Magie und des Opfers sind in subtilen Formen auch in heutigen Religionen gegenwärtig.
Der Umgang mit den unverfügbaren Bedingungen unserer menschlichen Existenz und deren Sinndeutung umschreibt von Anfang an die bleibende Basis von Religion. In den vorhistorischen Religionsformen und in den noch existierenden Naturreligionen bilden Natur und Religion eine untrennbare Einheit.
1.2.4 Die regionalen Hochreligionen
Die Religionen, die sich in unserem Kulturkreis seit 3000 v. Chr. in Vorderasien (bei Sumerern, Babyloniern, Assyrern, Hetitern, Kanaanitern u. a.) herauszubilden beginnen, nennen wir Hochreligionen, weil sie den nun entstehenden Hochkulturen entsprechen. Diese ältesten Hochkulturen entwickeln eigene Schriftsysteme und Staatsgebilde mit Herrschaftshierarchien und mit arbeitsteiliger Organisation. Das jeweilige religiöse Selbstverständnis bleibt das Dach und der Horizont, in deren Bereich sich die regionale Kultur differenziert und entwickelt. In den Hochreligionen werden die Gottheiten regional und ortsgebunden verstanden. Wir sprechen daher von »regionalen Hochreligionen«.
1.2.5 Die Blickrichtung der Menschen ändert sich
In den entstehenden Stadtkulturen sehen sich die Menschen nicht mehr als Jäger, Sammler, Hirten oder Ackerbauer der Natur voll ausgesetzt. Ihr Blick richtet sich also nicht mehr allein auf die vegetativen Mächte der Wälder, der fruchtbaren Erde und des fruchtbringenden Regens. Indem der Mensch sich seine städtische Welt baut, in der ein Herrscher die Richtung |3| und Ordnung vorgibt, richtet sich sein Blick über diese irdische Spitze hinaus nach oben zum Himmel. Das unverfügbare Andere sieht man nicht mehr in dieser Welt angesiedelt, sondern über dieser Erde im oder über dem Himmel, in einem Bereich, der uns unzugänglich ist. Dieses »über der Erde« bedeutet noch nicht »außerhalb«.
An die Stelle der vegetativen Mächte treten astrale Gottheiten (Gestirnsgottheiten), Götter, die im Himmel wohnen. Im mesopotamischen Raum wird bereits im 4. Jahrtausend v. Chr. ein Himmelsgott Anu verehrt. Die nahen, weiblich-mütterlichen Erdgottheiten, die irdische Geborgenheit geben, werden von fernen, Ordnung fordernden männlichen Gottheiten abgelöst. Auch die Stämme Israels, die um 1000 v. Chr. in Kanaan zu einem Volk zusammenwachsen, befinden sich in diesem Umbruchprozess.
1.2.6 Der Schritt zu den universalen Religionen
Seit der Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. bilden sich nahezu zeitgleich in den damaligen kulturell aktiven Zentren der Welt Religionen, die ihre regionalen Bindungen hinter sich lassen und universalen Charakter annehmen. Sie gehen zwar aus regionalen Hochreligionen hervor, streifen aber das regional Bedingte so weit ab, dass sie als Systeme des Weltverstehens, der Sinndeutung und des Handelns grundsätzlich für Menschen jedweder Kultur und Herkunft zugänglich werden. Religion wird damit zu einer eigenständigen Realität, die in jede Kultur hineinwirken kann. Zu jenen universalen Religionen zählen neben dem monotheistischen Judentum, aus dem Christentum und Islam hervorgegangen sind, auch der Buddhismus, der Konfuzianismus, der Taoismus und der indische Hinduismus.
|24| 1.2.7 Was mit »Religion« gemeint sein kann
Viele Gespräche über Religion enden in sinnlosen Streitereien, weil nicht geklärt wird, was die Gesprächsteilnehmer unter »Religion« verstehen. Das Wort »Religion« ist nun einmal ein vielschichtiger Sammelbegriff, der Unterschiedliches bezeichnen kann. Er kann bedeuten:
Das konkrete Sinnkonzept einer Gemeinschaft (Weltverständnis der Jäger, Sammler …).
Das organisierte Gefüge einer Kultgemeinschaft mit ihren Mythen und Ritualen (hellenistische Kulte aller Art).
Eine organisierte Glaubens- oder Bekenntnisgemeinschaft (christliche Kirchen).
Ein Weltanschauungskonstrukt (Ideologie oder Organisation wie z. B. Scientology Church).
Eine esoterische Gruppe.
Von »Religion« ist zu unterscheiden die »Religiosität« des Einzelnen.
Es empfiehlt sich, gemeinsam vorab zu klären, wovon man reden will!
1.3 Judentum, Christentum und Islam als Universalreligionen
1.3.1 Das Judentum
Die Universalreligionen, die man auch »Weltreligionen« nennen kann, sind weltweit um die Mitte des ersten Jahrtausends v. Chr. entstanden. Die ursprüngliche Universalreligion, die für Europa prägend geworden ist, ist das monotheistische Judentum. Dieses Judentum ist freilich eine Religion der Juden geblieben und dadurch zur Weltreligion geworden, dass jüdische Menschen und jüdische Gemeinden in aller Welt und in vielen Kulturen anzutreffen sind. Ihre Zahl liegt derzeit bei etwa 18 Millionen, das sind 0,4 Prozent der Erdbevölkerung.
Читать дальше