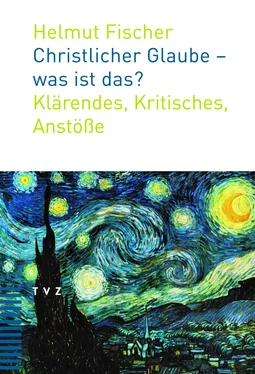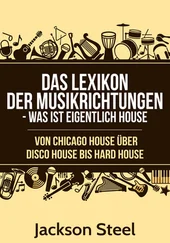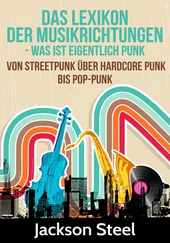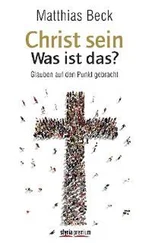Nach jüdischem Selbstverständnis und Gesetz gilt als Jude, wer eine jüdische Mutter hat. Das Judesein ist also in erster |25| Linie eine Frage der physischen Abstammung und erst danach ein Tatbestand religiöser Überzeugung. (Der Staat Israel hat in einem Rückkehrergesetz definiert, dass als Jude jeder Mensch gelte, »der von einer jüdischen Mutter geboren wurde oder sich zum Judentum bekehrt hat und nicht Mitglied einer anderen Religionsgemeinschaft ist«.) Es gibt auch einen Beitritt zum Judentum als Religion. Der aber ist kompliziert, und die jüdische Religionsgemeinschaft ist daran wenig interessiert. Das Judentum kann zwar weltweit und in allen Kulturen gelebt werden, bleibt aber im Wesentlichen auf Menschen jüdischer Abstammung beschränkt. Dennoch ist die jüdische Religion die Mutter der Universalreligionen Christentum und Islam. Das hängt vor allem mit ihrem Gottesverständnis zusammen.
1.3.2 Das frühe Gottesverständnis der Israeliten
Die Stämme Israels haben sich erst in Kanaan zum Volk Israel zusammengefunden. Diese Stämme lebten davor als Nomaden oder Halbnomaden, jedenfalls ohne Verankerung an einem festen Ort. Sesshafte Gruppen verehren Gottheiten der Erde und des Himmels, von denen sie Fruchtbarkeit der Felder und der Herden erwarten. In Kanaan ist El das Haupt der Gottheiten. Seine Gattin, die Göttin Ashera, gebiert ihm 70 Gottheiten und verkörpert das Prinzip des Gebärens. Baal war eine der männlichen Hauptgottheiten der Kanaaniter. Er zeigt sich im Donner und sendet den Regen. Anath, Gefährtin des Baal, ist Fruchtbarkeits- und Liebesgöttin. Die Vegetationsgöttin Astarte personifiziert die fruchtbringende Erde. Diese Gottheiten werden an uralten Kultstätten verehrt.
Nomadische Stämme haben keine ortsgebundenen Naturgottheiten. So hatten die nomadischen Stämme Israels, die kein Land besaßen, wohl auch keine Heiligtümer, in denen sie ihre Götter in Bildgestalt darstellen konnten. Nomaden haben Götter, |26| die mit ihnen gehen, die ortlos sind, die ihnen auf ihren Wegen nahe sind und die der Gemeinschaft Schutz gewähren.
Wir wissen nicht, welche der israelitischen Gruppen den Gott Jahwe in den Stämmeverband Israels eingebracht hat. Wir wissen lediglich, dass Jahwe nach der Landnahme zum Gott aller Stämme geworden ist, zu dem sich alle Israeliten um 1000 v. Chr. bekennen. Wahrscheinlich gab es im Land mehrere Jahwe-Heiligtümer. Daneben verehrten die nun sesshaften Israeliten wohl auch andere Götter und Göttinnen der Ureinwohner, die sie nun für ihre Felder und Herden brauchten. Dabei wird Jahwe vielfach mit Baal gleichgesetzt worden sein. Die Propheten haben immer wieder vor diesen anderen Göttern gewarnt. Dem ist zu entnehmen, dass in der Volksfrömmigkeit der Israeliten bis zum Exil (587–539) viele Götter verehrt worden sind, also Israels Volksreligion bis dahin polytheistisch war.
Was nun Jahwe betraf, so galt er als der Gott Israels, wie eben Baal der Gott der Kanaaniter war. Offiziell hatte Israel nur diesen einen Gott Jahwe. Als ihr Stammesgott war er einer unter vielen anderen Göttern der anderen Völker, deren Macht man nicht in Frage stellte. Dieses Gottesverständnis wird »Henotheismus« genannt.
1.3.3 Der Schritt zum Monotheismus
Der große und entscheidende Umbruch im Gottesverständnis ereignete sich in der Zeit des Exils und danach. Das ist den Texten der großen Propheten zu entnehmen. Jeremia und Ezechiel, die zu den Deportierten gehörten, versicherten ihren Leidensgenossen, dass Jahwe nicht in Israel geblieben, sondern auch in ihrem babylonischen Exil gegenwärtig und am Werk war.
Das neue Gottesverständnis formuliert ein Prophet, den wir den Zweiten Jesaja (Deuterojesaja) nennen und der seine Stimme erhebt, als die Perser 539 v. Chr. die Babylonier besiegen |27| und das Exil der Juden beenden. Dieser Zweite Jesaja sagt, dass Jahwe der Gott nicht nur Israels, sondern der Gott aller Völker ist. Er hat bereits die Babylonier aufgeboten, um Israel für seinen Abfall zu anderen Göttern zu strafen, und er hat auch die Perser mit einer historischen Rolle beauftragt. Jahwe erweist sich so als der Gott aller Völker. Er ist der einzige Gott. Die anderen Götter sind neben ihm reine »Nichtse«, nichtige Götzen.
Dieser eine und einzige Gott, der jetzt auch keinen Namen mehr braucht, wohnt nicht mehr in Kultstätten, sondern er ist jenseits von allem, was wir »Welt« nennen. Er ist überhaupt nicht mehr Teil dieser Welt, sondern steht ihr gegenüber. Deshalb ist er seinem Wesen nach unzugänglich, verborgen, anders, für Menschen nicht verfügbar und auch nicht sichtbar. Der große jüdische Religionsphilosoph Philo von Alexandrien (ca. 13 v. Chr. bis 40 n. Chr.), ein Zeitgenosse Jesu, hat sogar gesagt, Gott sei in seinem innersten Wesen eigenschaftslos, leidlos, unbeschreibbar. In Exodus 3,14 lautet die Selbstbezeichnung Gottes: »Ich bin der (unveränderlich) Seiende«. Von diesem Gott, der zu jeder Zeit als der Helfende und Barmherzige da und nahe ist, wissen sich die gläubigen Juden durch die Höhen und Tiefen der Geschichte begleitet. Er wird von jüdischen Glaubenden als personales Subjekt und als Gegenüber erfahren.
Jesus lebt und handelt aus diesem jüdischen Gottesverständnis und er verkündet durch sein Handeln und durch seine Gleichnisse, Wunder und Worte, dass die Herrschaft dieses Gottes nahe ist, ja, dass sie bereits jetzt anbricht, und zwar über die Grenzen des Judentums hinaus für alle Menschen. Der personal verstandene jüdische Monotheismus Jesu wird von der christlichen Theologie später zum trinitarischen Gottesverständnis ausgebaut, in das Jesus und der Geist einbezogen |28| sind. Der personale Monotheismus, der alle Völker umgreift, wird darin gegen viele Missdeutungen streng festgehalten.
Der Islam fasst sein Gottesverständnis, das er dem Judentum und dem Christentum entnimmt, in dem Satz zusammen: »Es gibt keinen Gott außer Gott«. In Sure 112 wird der islamische Monotheismus gegenüber dem Polytheismus und gegenüber einem nicht verstandenen Trinitätsglauben abgegrenzt.
1.3.6 Monotheismus und Universalreligion
Der Monotheismus sprengt alle regionalen und kulturellen Begrenzungen und bildet eine Basis für die Universalreligion. Das bedeutet freilich nicht, dass ein personales Gottesverständnis oder überhaupt eine Art von Gottesgedanke die Bedingung für eine Religion oder gar für eine Universalreligion wäre. So ist z. B. der Buddhismus eine nichttheistische Religion, die weder einen Gott noch eine Gottesverehrung kennt.
1.4 Religion und Kultur
1.4.1 Was ist unter »Kultur« zu verstehen?
Seit die Römer das Wort »Kultur« (cultura) erfunden haben, wird darüber gestritten, was darunter zu verstehen ist. In den Streit der Spezialisten müssen wir uns hier nicht einmischen. Für unseren Zusammenhang reicht jene weite Umschreibung, die allgemein anerkannt ist. Danach gilt als Kultur all das, was nicht von Natur aus gegeben ist, sondern durch den Menschen, durch dessen geistige und handwerkliche Fähigkeiten an Welt- und Lebensgestaltung hervorgebracht wird.
Darin sind vier Dinge hervorzuheben:
1 Kultur ist keine Sache des Einzelnen, sondern stets die Gesamtleistung einer Gruppe von Menschen, die in der Lage sind, sich untereinander zu verständigen.
2 |29| Von den frühesten Kulturen an war die Sprache die wesentliche Basis für das Entstehen und den Aufbau einer gemeinsamen Kultur.
3 Kultur ist keine starre Größe. Sie verändert sich mit den Lebensbedingungen und mit den Antworten, die die kulturelle Gemeinschaft auf die jeweils aktuellen Lebensfragen gibt. Kulturen sind historisch sich verändernde Ganzheiten.
4 Es gibt keine gewordene Gemeinschaft ohne Kultur, denn die Kultur macht gerade das Gemeinsame einer menschlichen Gemeinschaft aus.
Читать дальше