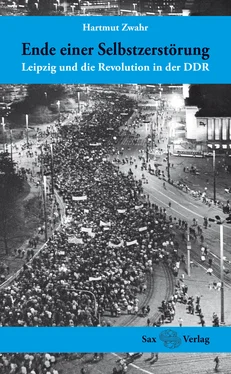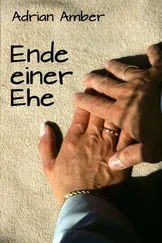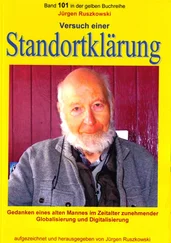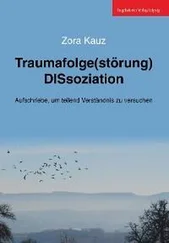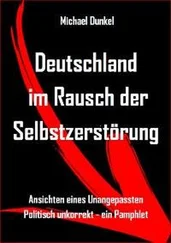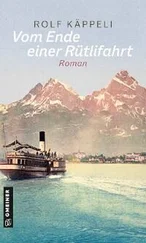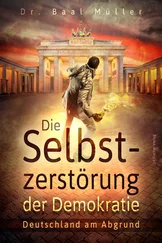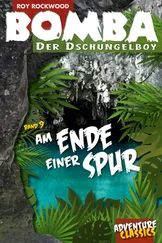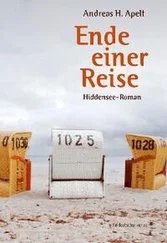In der Nacht zum 1. Oktober wies die Regierung der DDR die Botschaftsflüchtlinge in Prag (etwa 5.500) und Warschau (etwa 800) in die Bundesrepublik aus. 73Die Mitteilung des Außenministers des anderen Deutschland, daß sie dorthin würden ausreisen dürfen, hatten die Eingeschlossenen in der Prager Botschaft der Bundesrepublik mit einem Jubelschrei beantwortet. Dann fuhren sie in Sonderzügen der Deutschen Reichsbahn über Bad Schandau und Dresden Hauptbahnhof ein letztes Mal durch die Republik. Noch einmal demonstrierte die Staatsmacht an ihnen Staatsraison. Denn nur Heimgekehrte konnten ausgewiesen werden. Während dies geschah, überreichte in Berlin der Minister für Nationale Verteidigung Fahnen an Formationen der Zivilverteidigung. 74In Leipzig erhielt die Formation Weise eine solche Fahne während eines feierlichen Kampfgruppenappells am Völkerschlachtdenkmal. Die ›Kämpfer‹ ahnten vermutlich nicht, daß es einen solchen Appell nie mehr geben würde. Zu Hause erlebten sie am Fernsehen die Ankunft der Ausgewiesenen in Hof und in Helmstedt. Junge Leute warfen Mark und Pfennige weg, als hätten sie nie damit bezahlt. Die DDR eine schlechte Münze. »Sie schaden sich selbst und verraten ihre Heimat«, urteilte der Generalsekretär. Er gebrauchte das alte Muster einer teuflischen Verführung, um das Geschehene zu erklären. Das »vorgegaukelte Bild vom Westen« solle vergessen machen, »was diese Menschen von der sozialistischen Gesellschaft bekommen haben und was sie nun aufgeben«. Sie hätten sich selbst »ausgegrenzt«. 75
Die Signale der Macht wirkten aufreizend. Auf der Titelseite des »Neuen Deutschland«, das am Montagmorgen erschien, war zu sehen, wie Deng Xiaoping und Egon Krenz, der persönliche Grüße Erich Honeckers und die Glückwünsche zum 40. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik überbrachte, sich am Vortag in Peking Im Zeichen der Stärkung des Sozialismus die Hände gereicht hatten. Krenz, im Halbprofil, lacht. Der Greis hat die Grußhand des Gastes mit seinen beiden kleinen Händen ergriffen, und dieser legt seine Linke wie einen Schutzschild darüber. So haben die Leser des Zentralorgans und tags darauf der SED-Bezirkszeitungen Krenz in ihrer Erinnerung aufbewahrt. »Wir verteidigen die gemeinsame Sache des Sozialismus, ihr in der DDR, wir in der Volksrepublik China«, versicherte Deng. »Wir haben letzten Endes in diesem Kampf gegen den konterrevolutionären Aufruhr gesiegt, weil wir uns auf die kollektive Stärke unserer Partei und des Volkes stützten, trotz der ernsten Fehler des Genossen Zhao Ziayang, den Aufruhr zu unterstützen und die Partei zu spalten.« 76Dieses Titelbild verhieß nichts Gutes. Ein Blick auf den händeschüttelnden Krenz genügte, um zu begreifen, daß da eine chinesische Lösung angedroht wurde. 77
An diesem Montag begann in Berlin die Jubelwoche zum 40. Jahrestag der DDR. Sie sollte für viele zu einer Schmerzenswoche, zu einer Karwoche werden. Während der Generalsekretär und Vorsitzende des Staatsrats in Anwesenheit von Armeegeneral Keßler, Generaloberst Streletz und dem Leiter der Abteilung Sicherheitsfragen des SED-Zentralkomitees, Herger, Generale ernannte, ehrte der Stellvertreter des Staatsratsvorsitzenden, Politbüromitglied Sindermann, verdiente Persönlichkeiten und Kollektive in Würdigung besonderer Verdienste beim Aufbau und der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaftsordnung und der Stärkung der DDR. Er überreichte höchste Orden, zuerst die Ehrenspange zum Vaterländischen Verdienstorden, zuletzt den Orden »Banner der Arbeit«. Im Anschluß an den Ernennungsakt bei der Armeeführung beförderte Honecker im Beisein von Minister Mielke Generale und Oberste des Ministeriums für Staatssicherheit. Aus seinen Händen nahmen Getreue auch den Scharnhorstorden entgegen. Wer die Fotos betrachtet 78und den Gang der Ereignisse kennt, sieht den Boden unter diesen Männern schwanken. Zu anderer Stunde empfing der Staatsratsvorsitzende den Verleger Maxwell; dieser überreichte aus gegebenem Anlaß die britische Ausgabe des Handbuchs DDR. Das Foto zeigt, wie der Beschenkte sich selbst wohlgefällig betrachtet. 79Er konnte nicht wissen, daß es das große, farbenprächtige Porträtfoto neben dem Titelblatt nur in diesem einen Exemplar gab. Das Büro Honecker hatte es anders gewünscht, am Ende hatte man sich mit dem Verleger auf eine Täuschung geeinigt. Dem Generalsekretär, ohne dessen persönliche Zustimmung keine Seite des »Neuen Deutschland« in Druck gehen konnte, blieb sie verborgen.
An diesem 2. Oktober bereisten Politbüromitglieder und ihr Gefolge die Republik. Hager sprach in Begleitung von Bezirkssekretär Ziegenhahn vor Werktätigen in Gera; der Ministerratsvorsitzende Stoph tat dasselbe in Dresden, begleitet von Bezirkssekretär Modrow; nur Inge Lange, die Kandidatin des Politbüros und als Frau dort in einer Statistenrolle, blieb ohne eine solche gehobene Begleitung. In Berlin-Pankow wurde das Carl-von-Ossietzky-Denkmal enthüllt. »Ich bin tief berührt von der Ehrung«, 80sagte Rosaline von Ossietzky-Palm, die Tochter dieses Märtyrers der deutschen Demokratie, zu Politbüromitglied Schabowski, dem Berliner Ersten Bezirkssekretär, neben ihm Berlins Oberbürgermeister Krack – Wahlfälscher der eine, zum engsten Stasi-Info-Verteiler-Zirkel der Macht gehörend der andere. 81
Im Panzerschrank Schabowskis lagen zu diesem Zeitpunkt die streng geheimen und zur Rückgabe an Mielke bestimmten Informationen 433/89 und 434/89 vom 2. Oktober. 82Sie gaben bis in die Details Aufschluß über Vorbereitungen zur Gründungsversammlung des »Demokratischen Aufbruch«, die am 1. Oktober, als die Züge mit den Ausgewiesenen durch die Republik rollten und Krenz vor Deng stand, in der Samariterkirche zu Berlin-Friedrichshain stattfinden sollte, dann aber unterbunden wurde. »Einsatzkräfte« der Deutschen Volkspolizei verwehrten den Gründern den Zutritt. Zusammenkünfte im kleinen Kreis, von den Überwachern als »Ausweichvariante« bezeichnet, schlossen sich an. Man traf sich in der Wohnung von Pfarrer Neubert, 83einem Studienreferenten des Bundes Evangelischer Kirchen, sowie im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchgemeinde Alt-Pankow, wo Bischof Forck dem Stellvertreter des Stadtbezirksbürgermeisters die gewünschte Einsicht in die Diskussionspapiere verweigerte. Forck, angeblich »in Leugnung des tatsächlichen Anlasses und Inhaltes der Zusammenkunft«, erklärte, man rede im Rahmen einer ökumenischen Begegnung über aktuelle Fragen von Frieden und Gerechtigkeit. Der Bischof wurde aufgefordert, die nicht religiösen Charakter tragende Zusammenkunft zu beenden. Er lehnte das ab. Die »Informationen« nannten die Pfarrer Neubert, Eppelmann, Schorlemmer, Meckel, Albani, Pahnke, Pastorin Misselwitz, Probst Falcke, Vikar Schatta, den Synodalen Fischbeck, Delegierter im konziliaren Prozeß in der Synode Berlin-Brandenburg wie im Kuratorium der Evangelischen Akademie, und andere als Beteiligte.
Der Physiker Hans Jürgen Fischbeck hatte am 13. August 1989 in der Ostberliner Bekenntnis-Gemeinde zur Gründung einer einheitlichen Sammlungsbewegung der Opposition aufgerufen. An diesem Tag hatten Großbritannien und die USA ihre Botschaften in der DDR geschlossen, nachdem Tausende das Land in Richtung Ungarn verlassen hatten und die Ständige Vertretung der Bundesrepublik in Berlin (Ost) wegen Überfüllung schon am 8. August geschlossen worden war. In einigen der etwa 500 Basisinitiativen, die es in der DDR gab, war Fischbecks Vorschlag seit Monaten in der Diskussion. Der Synodale vertrat die innerkirchliche Gruppe »Absage an Prinzip und Praxis der Ausgrenzung« gegenüber einer Politik, die Honecker betonköpfig befolgte. Als die Leipziger sie mit dem Demospruch Wir lassen uns nicht auskrenzen! beantworteten, zielten sie gegen zwei Generalsekretäre und Staatsratsvorsitzende, Honecker und Krenz. Fischbeck erklärte, Marx und Engels hätten keine verstaatlichte Gesellschaft gewollt, bevor er, eines der vielen Perestroika-Defizite in der DDR benennend, sagte: »Der Sozialismus in dieser Form ist nicht vereinbar mit ehrlicher Offenheit, mit Glasnost. Nirgends, außer im ›Neuen Deutschland‹, steht geschrieben, daß der Sozialismus nur auf diese Weise zu erreichen ist«. 84Die innere Öffnung sei auch der einzige Weg, die Mauer abzubauen. Die Pfarrer Eppelmann und Meckel waren wichtige Vertreter demokratischer alternativer Parteibildung, Meckel als einer der vier Unterzeichner des Aufrufs der Initiativgruppe »Sozialdemokratische Partei in der DDR« vom 26. September, 85Eppelmann als einer der Initiatoren des Aufrufs vom 1. Oktober, 86der an die Gründung der Partei »Demokratischer Aufbruch (DA)« heranführte. Friedrich Schorlemmer, Wittenberg, als Pfarrer und Bürgerrechtler Mitverfasser der »20 Thesen zur Erneuerung der Gesellschaft« vom Kirchentag 1988 in Halle, war es, der am 4. September in der Reformierten Kirche zu Leipzig mit den 300 Bleibewilligen diskutiert hatte. Sein Ziel hieß: Erneuerung, nicht Emeritierung des Sozialismus. Entweder sei dieser von Peking bis Berlin reformfähig, oder er verschwände erst einmal von der Bildfläche. 87
Читать дальше