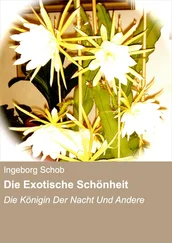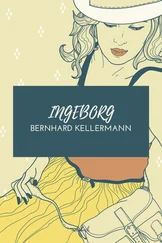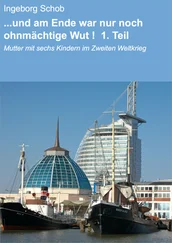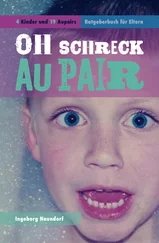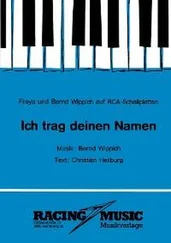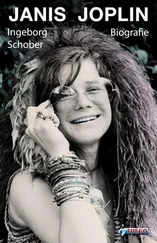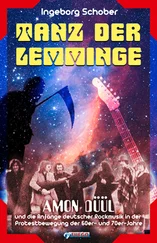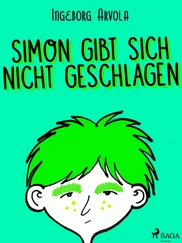Im Oktober 1966 gab sie ihre erste Pressekonferenz als weltliche Künstlerin Luc Dominique und bekam das, was man heute in der Showbranche ein Image-Problem nennt. Bislang hatte sich die sogenannte »Twistnonne« oder »religieuse yé-yé« als Exotikum in fliegender Kutte trefflich vermarkten lassen. Doch als etwas altbacken wirkende Durchschnittsfrau in Zivil mit dicker Brille verlor sie jeglichen Reiz für Presse und Publikum und musste zudem mit anderen, weltlichen Sängerinnen konkurrieren, ohne für das Showgeschäft präpariert zu sein. Für die Zeitschrift »McCall's« sah das so aus: »Sie wirke schüchtern, nicht gerade fröhlich, so, als würde sie sich in ihrer Haut nicht wohlfühlen. Sie ist bis auf etwas rosa Lippenstift ungeschminkt und sieht fünf Jahre jünger aus. Sie trägt eine Blümchenbluse über einem grauen, knielangen Faltenrock. Ihre langen, schlanken Beine betonen hochhackige, schwarze Pumps, in denen sie erst kürzlich zu laufen gelernt hat.« An anderer Stelle wurde sie in diesem Artikel auch als »breitschultrig«, mit »Hängebusen« und »matronenhafter Haltung« beschrieben. Die Schlagzeile dazu lautete: »Sie trägt Pumps, raucht bisweilen und lobt in einem Lied die Pille.«
Die Welle der christlichen Chansons war inzwischen abgeebbt, also versuchte sie 1967 auf ihrem Album mit dem programmatischen Titel »I'm Not A Star« den textlichen Spagat zwischen Weltlichem und Religiösem. Sie besaß durchaus das Talent, schwierige Themen weiterhin fröhlich-naiv zu verpacken und zeigte sich zusehends als eine Streiterin für Emanzipation und die Modernisierung der Kirche. Bisweilen wurde ihre Selbstironie jedoch gründlich missverstanden, vielleicht bewusst, weil ihr Spott auch nicht vor der Presse haltmachte, die sie als singende Nonne verklärt hatte. Wie etwa auf dem oft zitierten Song »Luc Dominique«, mit dem sie die singende Nonne zu Grabe trug. »Soeur Sourire ist tot - sie ist tot, es wurde Zeit …« »Ich mache mich über die Herren Journalisten und Plattenhändler lustig, die bestimmt wieder alles falsch verstehen und schimpfen werden. Aber der heilige Dominikus mag ihnen die Gerüchte vergeben, die sie jetzt wieder in Umlauf bringen werden.«
Doch Luc Dominique war längst nicht so selbstsicher, wie sie sich gab, im Gegenteil. Ihre Zweifel wuchsen. Der Zeitschrift »Constanze« erklärte sie: »Ich fühle mich schrecklich unter Druck. Man investiert so viel Geld in mich. Was aber, wenn ich scheitere?« Mit den Zweifeln kamen auch die Widersprüche. Das Leben im Kloster war einfach gewesen, dort waren die Regeln in einer klar strukturierten Lebensgemeinschaft vorgegeben. Mit einem Mal war sie einer Welt ausgesetzt, von der sie wenig Ahnung hatte, auch den Versuchungen, die diese neue, ungewohnte Freiheit mit sich brachte. Sie wurde mit Karriereentscheidungen konfrontiert, ohne professionelle Berater zu haben - doch auf diese Idee kam sie wohl ohnehin nicht, im festen Glauben an Gott.
Und es blieb ihr keine Zeit, sich langsam anzupassen und zu lernen. Denn von Beginn an stand sie bei jedem Schritt im Scheinwerferlicht. Sie war offen und ehrlich und sang und sagte immer eins zu eins, was sie dachte, weil sie es so gelernt hatte. Und damit machte sich die weltfremde Luc Dominique verletzlich und für jedermann angreifbar. So gab sie etwa unumwunden zu, dass sie unter Schlafproblemen leiden und deshalb Tranquilizer nehmen würde, und gestand: »Auch wenn ich bisweilen dem Luxus fröne, ich weiß, es ist besser diesen Versuchungen zu widerstehen.« Und dichtete deshalb für das Lied »Je ne suis pas une vedette« die Zeilen: »Man überreicht mir eine Goldene Schallplatte. Was soll ich damit anfangen? Man sagt mir: ›Das ist doch phantastisch. Jetzt sind Sie Millionärin!' - 'Eh oui, vergessen Sie nicht, ich bin kein Star. Sie irren sich. Wenn der Herr mich hat zum Star werden lassen, dann nur, damit ich aus ihm einen Star mache …‹«
Früher hatte sie Launiges über ihre Gitarre Adèle »Soeur Adèle« gesungen, über Gottes wunderbare Schöpfung, über religiöse Ziele und Trost durch den Herrn. Nun setzte sie sich - wohlgemerkt immer noch in dessen Namen - vermehrt für weltliche Dinge ein und schien es geradezu auf Provokation anzulegen. Zumindest ließ sie kein Fettnäpfchen aus, wenn es zu der einen oder anderen Textverirrung kam. In dem Song »Bain de soleil« erkennt sie die Allmacht Gottes nicht nur in den wärmenden Sonnenstrahlen, sondern sogar in der Evolution und in der Radioaktivität.
In ihrem kämpferischen und mutigen Song über die Antibabypille im modernen Mariachi-Sound »La Pilule d'Or« (»Die goldene Pille«) wagte sie sich an ein damals geradezu politisch brisantes Thema und löste einen Skandal aus. Die Antibabypille war noch heftig umstritten und der Papst hatte sie den Katholiken verboten. Dennoch pries sie Gott hymnisch für seine Weisheit und dankte ihm für dieses Geschenk, mit dem er viel irdische Not verhindern würde. Indirekt ist das Lied damit auch ein Plädoyer für freie Liebe, für eine gesunde Sexualität ohne Folgen für die Frau: »Als unsere Großmütter ihren Hausstand gründeten, sagte man ihnen: 'Meine Tochter, sei brav und deinem Manne untertan. Setz eine große Familie in die Welt und empfange in Freuden die Kinder, die Gott dir schickt.' Heute ist die goldene Pille da. Die Biologie hat einen großen Schritt getan. Herr, wir preisen dich.«
Luc Dominique hatte sich nicht vom Glauben ab gewandt, aber von der Institution Kirche.
Das war starker Tobak, zumal sie in Interviews den Papst wegen seiner strikten Ablehnung der Pille persönlich angriff: »Er sollte die Antibabypille befürworten, denn das ist das einzig Intelligente und Richtige, was er tun kann. Ich finde es schockierend, dass sie nicht jeder Frau, die sie haben möchte, zur Verfügung steht ...« Diese liberale Haltung brachte ihr zunehmenden Ärger mit der Kirche ein, zumal sie in einem anderen Lied, »Le Temps des femmes«, mutig gewettert hatte: »Mönche und Pfarrer, misogyne Gesellschaft, erblicken in der Frau die ewige Versuchung und tolerieren sie nur, wenn sie ihnen die Küche macht.« Und als nach John Lennons flapsiger Bemerkung, die Beatles wären heutzutage populärer als Jesus, alle Welt empört aufschrie, erklärte sie: »Auch wenn ich das nicht gut finde, kann man das nicht bestreiten.«
Von der Presse erntete sie für ihre Einstellung jedoch nur Häme. Für die Journaille war sie eine frustrierte Emanze, eine männergeile Ex-Nonne, deren Stern am Verblassen war. Doch statt einem Mann hatte sie inzwischen eine um zehn Jahre jüngere Frau als Lebenspartnerin. Homosexualität war damals ein Tabuthema, an das sich nicht einmal die Presse offen heranwagte. Ob die Lebensgemeinschaft mit Annie Pécher wirklich eine lesbische Beziehung war, darüber ist sich nicht einmal die Buchautorin und Biografin Florence Delaporte sicher. Sie hat für ihr Buch »Soeur Sourire: Brûlée aux feux de la rampe« (Im Fegefeuer des Rampenlichts) eintausend Seiten Tagebuchnotizen ausgewertet. Alles, was sich dabei herauskristallisierte, war, dass allein das Gerücht, das Paar sei lesbisch, beiden mehrmals den Job gekostet hat. So bezeichnete etwa die »Bild am Sonntag« in ihrem »Nachruf« die Ex-Nonne als »die Lesbe mit dem Heiligenschein«.
Die beiden Frauen hatten ihr Leben vor allem der Hilfe anderer verschrieben. Annie Pécher hatte ein Heim für autistische Kinder gegründet, das ihre Partnerin anfangs kräftig mitunterstützte. Doch angesichts sinkender Verkaufszahlen wurde Luc Dominique depressiv, sie schluckte Pillen und absolvierte eine Psychotherapie, da sie auch ihren Pflichten als Laienschwester kaum mehr gewachsen war und nur noch gelegentlich unterrichtete. Aber auch, weil sie nach einer ausgedehnten Amerikatournee aufgrund ihrer Schüchternheit nur sporadische Liveauftritte absolvieren konnte, obwohl sie das Geld dringend benötigte. Und sie machte in ihrer Verzweiflung einen weiteren, folgenschweren Fehler: weil ihre Karriere unter dem Namen Luc Dominique so gut wie stagnierte, nannte sie sich wieder Soeur Sourire.
Читать дальше