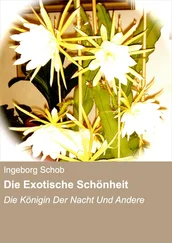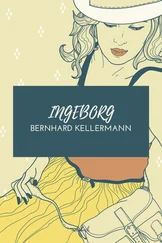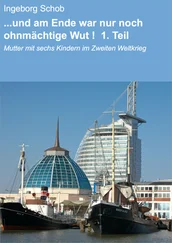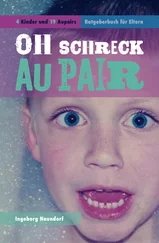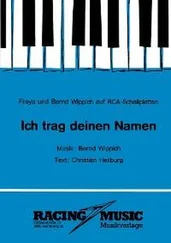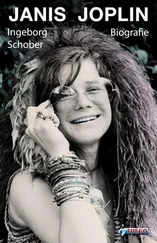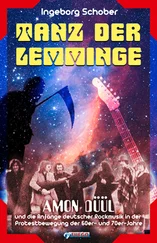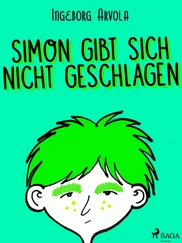»Dominique, Dominique, der zog
fröhlich in die Welt, zu Fuß und ohne Geld.
Und er sang an jedem Ort immer wieder Gottes Wort ...
Ohne Pferd und ohne Wagen zog er durch Europa hin,
denn die Armut war ihm heilig, sie war seines Lebens Sinn ...«
Domingo de Guzman hatte 1215 den Bettelorden gegründet, der durch Predigt und Unterricht die dem Papsttum feindlich gesinnten Albigenser »zurück auf den rechten«, also papsttreuen
Kurs bringen sollte. Er wurde später heilig gesprochen. Luc-Gabrielle beschrieb in ihrem Lied »Dominique« fröhlich und beschwingt das Leben des »mutigen und braven Heiligen«. Natürlich wies sie dabei weder auf die Rolle des Ordens in den blutigen Kriegen gegen die Albigenser oder gar auf die führende Rolle der Dominikaner während der Inquisition hin. Kritik an der Kirche prägten erst ihre späteren Texte. Als sie ein Plattenstudio für eine kostenlose Aufnahme fand, machte sie der Schwester Oberin eine Single des Liedes zum Geschenk. Diese beschloss, mit der Platte Geld für die Missionarsarbeit des Ordens in Afrika zu sammeln, obwohl sie sich später sehr abfällig über den Song äußerte - »zu kavaliersmäßig und oberflächlich«. In der »Newsweek« wurde sie später gar so zitiert: »Der heilige Dominik wurde hier mit plumper Vertraulichkeit und mit einem Anflug von Impertinenz abgehandelt.« Im Verlauf der Zeit wurde klar, dass das Verhältnis der beiden Frauen von Anfang an großen Spannungen unterlag.
Auf Umwegen bekam der holländische Plattenkonzern Philips die Single zu hören, erkannte das Verkaufspotenzial und nahm die singende Nonne unter Vertrag. Zu Recht witterte man dort einen neuen Hit, denn religiöse Popschlager und klerikale Chansons schienen nach dem Erfolg von »Danke für diesen guten Morgen« von Jesuitenpater Père Duval der neueste Trend zu sein und standen entsprechend hoch im Kurs. Das ging Hand in Hand mit der kirchlichen Öffnung: Mit dem 2. Vatikanischen Konzil - 1962 von Papst Johannes XXIII ins Leben gerufen - wurde die Modernisierung der katholischen Liturgie vorangetrieben. Damit sollten auch die Laien gestärkt und der Gedanke der Ökumene gefördert werden.
Trotzdem durfte Luc-Gabrielle als Nonne natürlich keine Geschäfte tätigen, also wurde der Plattenvertrag mit dem Orden abgeschlossen. Den miserablen Bedingungen nach standen der Nonne drei Prozent von den insgesamt neunzig Prozent des belgischen Großhandelspreises und lächerliche anderthalb Prozent für Auslandsverkäufe zu. Laut Vertrag durfte sie weder den Ordensnamen nennen noch Fotos von sich veröffentlichen. Beides Punkte, bei denen sich der Orden in den kommenden Jahren wie in vielen anderen Dingen ebenso inkonsequent wie unmenschlich verhielt.
Da die Plattenfirma ohnehin nach einem griffigen Künstlernamen suchte, beauftragte sie eine Schulklasse mit dem Brainstorming und der Gewinner auf der Vorschlagsliste war »Soeur Sourire«, die »lächelnde Nonne«. 1963 wurde die Single »Dominique«, teils englisch, teils französisch gesungen (später folgte auch eine deutsch gesungene Version) veröffentlicht. Die Zeichnung der musizierenden Nonnen auf dem Plattencover stammte von Soeur Sourire selbst, die später auch den Umschlag für die LP »The Singing Nun« gestaltete.
Die Nonne ließ sich bestens vermarkten - und bald war im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle los. Das naive Chanson wurde binnen kürzester Zeit ein Hit in Belgien und Frankreich, eroberte die Top Ten von Deutschland und den Beneluxländern und avancierte zum weltweiten Millionenseller mit unzähligen Coverversionen - und zur Hymne von Pfadfindern und Wandervögeln. Der singenden Nonne gelang sogar etwas, was bis dahin nur Elvis Presley geschafft hatte: sowohl die LP »The Singing Nun« als auch die ausgekoppelte Single »Dominique« standen im Dezember 1963 auf Platz 1 der US-Charts. Die Single verdrängte gar Elvis Presley von der Chartspitze, wurde als erste europäische Single - und bis heute als einzige aus Belgien - mit einem Grammy ausgezeichnet, und zwar in der Kategorie »Bester Gospel beziehungsweise religiöse Musikaufnahme«.
Als sie das Angebot bekam, 1964 in der populären, amerikanischen Fernsehsendung The Ed Sullivan Show aufzutreten, lehnte der Konvent das natürlich ab. Doch man hat nicht mit der Hartnäckigkeit und Chuzpe der Fernsehmacher gerechnet, die eines Tages mit dem Talkmaster Ed Sullivan persönlich samt einem riesigen Team im Kloster Fichermont auftauchten und von dort aus live berichten wollten. Da in Amerika schon damals Gospelgottesdienste und Fernsehprediger zum festen Programm gehörten, gab man sich mit der Absage der Mutter Oberin nicht zufrieden. Schließlich wurde die Erzdiözese eingeschaltet, die eine Einwilligung zu einer Filmaufzeichnung gab, die später im Rahmen der Fernsehshow lief.
Ungeübt im Umgang mit Presse und Öffentlichkeit, erzählte Soeur Sourire bisweilen ziemlich seltsame Geschichten. So schilderte sie einem Journalisten die kleinen Freuden im ansonsten strengen Klosterleben so: »Ab und an mal stellen wir die Heiligenbilder auf den Kopf, das ist mehr als heiter.«
Die gesichtslose Nonne in Habit mit Haube, mit einer dicken Brille und dem breiten, etwas verklärten Lächeln, die einfach so nebenbei einen Grammy kassiert hatte, erregte natürlich bald das Interesse von Hollywood. Kinofilme über mildtätige, sich aufopfernde Nonnen waren schon immer sehr beliebt. Und eine echte, junge Nonne, die auch noch singen konnte, kam den Drehbuchautoren gerade recht. 1966 wurde das Thema mit der keimfreien Blondine Debbie Reynolds unter dem Titel »Dominique - die singende Nonne« verfilmt. Regisseur des sentimentalen Machwerks über eine moderne, auf dem Motorroller mit ihrer Gitarre herumdüsenden Nonne, die sich dann auch noch ganz irdisch verliebt, war Henry Koster. Die idealistische Filmnonne Ann will unbedingt Kindern in Not helfen und begegnet einer alten Liebe wieder, was zu einer angedeuteten Romanze führt. Doch schließlich entscheidet sie sich für die Missionarsarbeit in Afrika und verschenkt gar die geliebte, allzu weltliche Gitarre. Soeur Sourire selbst distanzierte sich von diesem moralinsauren Melodram mit den Worten »reine Erfindung«, die Kritiker taten es als »süßliche Pappe« ab, obwohl es eine Oscar-Nominierung für die Musik gab.
Als der Film in die Kinos kam, wurde der Mutter Oberin der ganze Medienrummel schließlich zu viel. Sie verbot Schwester Luc-Gabrielle einen neuen Plattenvertrag zu unterschreiben, was zum endgültigen Bruch zwischen ihr und dem Orden führte. Sowohl der Fernsehauftritt als auch die Interviews, vor allem aber der Filmvertrag dürften dem Orden allerdings ein ganz ordentliches Sümmchen eingebracht haben, von dem die naive Nonne kaum etwas sah.
Schwester Luc-Gabrielles eigenes, ungetrübtes, idyllisches, fast himmlisches Märchen im Breitwandformat bekam damals die ersten Risse. Für die Nonne, die mit ihrer Stimme klar wie Quellwasser die zynische Welt der Medien erobert hatte, warteten die wirklichen Probleme allerdings draußen vor den schützenden, wenn auch für sie einengenden Klostermauern. 1966 verließ sie als eine der ersten geweihten Laienschwestern das Kloster Fichermont. Damit gehörte sie weiterhin dem Dominikanerinnenorden an, lebte aber nicht mehr im Konvent. Das Kloster stellte zwei knallharte Bedingungen: Sie durfte für weitere Platten nicht mehr ihren weltberühmten Künstlernamen Soeur Sourire benutzen, und sie durfte das Kloster keinesfalls mehr in irgendeinem Zusammenhang erwähnen. Damit wurde Luc Dominique - wie sie nun hieß - vom internationalen Markenartikel über Nacht zur unbekannten Sängerin. Von Geschäften verstand die Ex-Nonne rein gar nichts. Gemäß dem Armutsgelübde hatte sie als Schwester Luc-Gabrielle den Löwenanteil ihrer Tantiemen aus dem Plattenverkauf an den Orden abgeführt, der auch nach ihrem Austritt weiterhin ihre Finanzen betreute - ein tödliches Verhängnis, wie sich später herausstellen sollte.
Читать дальше