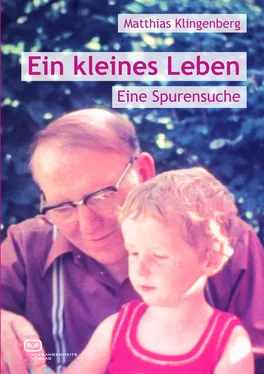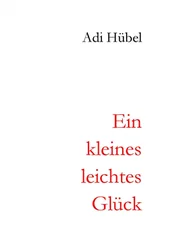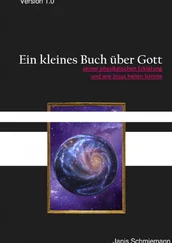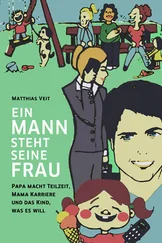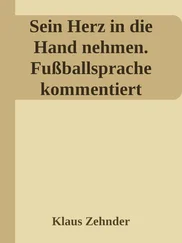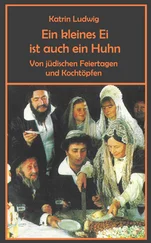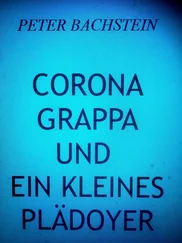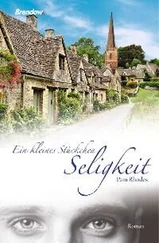Hat er es noch im gleichen Jahr beschrieben oder war es ein alter Kalender, der erst später, in Ermangelung einer Alternative oder in einem Anflug von protestantischer Sparsamkeit, für den Kriegsbericht herhalten musste? Unwahrscheinlich, dass er ihn noch im gleichen Jahr, als der Kalender noch gültig war, nutzte. Vielleicht ein oder zwei Jahre später, das erscheint mir realistischer. Also 1959 oder 1960? Diese Datierung wirft dann aber neue Rätsel auf, denn wie hat er sich an all die exakten Daten und Adressen des Kriegsberichtes erinnern können, es waren ja mindestens dreizehn Jahre seit Kriegsende vergangen (wenn wir vom frühestmöglichen Jahr 1958 ausgehen). Irgendwo musste er das alles vorher schon einmal aufgeschrieben haben. Auf losen Zetteln? In einem Kriegstagebuch? Es findet sich in seinen Sachen leider kein Anhaltspunkt, der hier weiterführen würde. Hat er die ursprünglichen Aufzeichnungen nach dem Übertragen in den Kalender vernichtet? Wenn ja, warum? Hat er bei der Auswahl dessen, was er übertragen hat, aussortiert, gefiltert? Hatten die ursprünglichen Aufzeichnungen auch die Zeit von Mai 1942 bis zum Kriegsende 1945, so wie der getippte Bericht ja übertitelt ist, umfasst?
In einen solchen Spiralkalender, ein Werbegeschenk der Hannoveraner Firma, hatte Karl seinen Kriegsbericht (oder war das schon die zweite Version?) handschriftlich eingetragen, den eigentlichen Kalender einfach überschreibend. Das einzige schon erwähnte, noch erhaltene Blatt beginnt mit dem durchgestrichenen letzten Satz des getippten Berichtes: „[D]ann begann der weitere Vormarsch.“ Danach folgt: „In russischer Gefangenschaft ... Gottswalden (oder Gottswaldern) ... bei Luckenwalde.“ Das Wort „Gottswalden“ ist mit einem krakeligen Strich umkreist, der Stadtname „Luckenwalde“ mit ebensolcher Strichführung unterstrichen. Die nächsten sechs Tagesfelder enthalten keine Schrift; den ersten Februar ziert eine weitere Ortsangabe: „Jüterboch (oder Jüterbock)“ – gemeint ist wohl das bei Luckenwalde liegende Jüterbog. Den Rand hat Karl (in Gedanken versunken?) mit gleichmäßigen Strichen markiert. Jeder kurze Strich ein weiteres Ereignis, das dem unvollendeten Kriegsbericht später hinzugefügt werden sollte. Oder markieren diese Striche die Begebenheiten, die Karl bewusst ausgespart hat?
Das Tagesfeld vom 30. Januar ist mit zehn senkrechten kurzen Strichen, wie bei einer Addition, einer Aufzählung versehen. Zehn krakelig nebeneinander gesetzte Striche. Auf das Durchstreichen der ersten vier mit dem fünften hat er verzichtet, also doch keine Zählreihe? Das Wochenkalenderblatt weist ein paar weiter unzusammenhängend scheinende, scheinbar wahllos hingekritzelte Striche auf. Es scheint ziemlich offensichtlich, dass Karl irgendwann später die handschriftlichen Kalenderseiten abtippte und dabei das schon Erledigte durchstrich. Der getippte Kriegsbericht ist also – höchst wahrscheinlich – erst sehr viel später entstanden. Ich erinnere mich selbst noch an den Kalender als Ganzes. Ich erinnere mich, wie Karl ihn mir zeigte, aus ihm vorlas, erklärte. Vielleicht war es ja sogar mein eigenes Interesse, dass ihn – es muss wohl irgendwann Mitte der 1980er-Jahre gewesen sein – dazu bewegte, das Ganze nochmal in Reinschrift zu bringen. Vielleicht konnte er sich zu diesem Zeitpunkt auch schon gar nicht mehr an das erinnern, was er bei der ersten handschriftlichen Niederschrift ausgelassen hatte. Wenn, dann sicherlich nur noch bruchstückhaft. Und wollte er das überhaupt, sich erinnern an diese letzten drei Kriegsjahre: Mai 1942 bis Mai 1945?
1958. In diesem Jahr, im September, war Karl Krüger vierundvierzig Jahre alt geworden. Ein guter Zeitpunkt für eine Rückschau, ein Resümieren, ein Nachdenken über Erlebtes? Verarbeitung, Verklärung, Vergessen. Fragen gehen mir durch den Kopf: Warum schreibt man einen Kriegsbericht? (Und dann noch einen, der mehr an ein Itinerar erinnert, Narratives fast völlig auslässt.) Für die Nachwelt? Weil einem die Traumata des Krieges täglich aufs Neue begegnen? Für seine(n) Enkel? Und wieder: Warum lässt man dann das ‚Spannendste‘, den Vormarsch auf Stalingrad, den totalen Krieg, den Untergang aus? Weil es zu traumatisch wäre, darüber zu schreiben? Weil es unmöglich ist, den Stift anzusetzen und das Unsagbare zu sagen? Warum? Was ist da passiert?
Ich versuche, in den Menschen Karl Krüger hineinzuschauen, mich in ihn hineinzugraben. Je tiefer ich vordringe, desto mehr Rätsel gibt er mir auf.
„Ab August 1942 setzte die 71. Infanterie-Division über den Don, nahmen Karpowka und Rossoschka, bis sie schließlich Stalingrad erreichte. Hier wurde die Division im Januar/ Februar 1943 vernichtet.“ So das Ende eines Kampfberichtes aus dem Internet.
Und dabei fing doch alles so gut an. Verfolgt man die Wegstrecke der ersten drei Jahre, liest sich der Bericht – und ich nehme hier die mündlichen Berichte meines Großvaters an mich als seinen Enkel hinzu – eher wie die Abenteuerreise eines 23-Jährigen: Eingezogen im August 1938, zugeteilt einer Nachschubeinheit, von da nach Kaiserslautern, dann Pirmasens zur Bewachung eines Munitionslagers am Westwall. Weiter, Ende des Jahres, nach Ruschberg bei Marnheim in Rheinland-Pfalz, Niederkirchen, Grumbach und dann Kompaniefriseur (!) in Niederkirchen bei Deidesheim, eine wunderbare Weingegend nebenbei. Vom 18.12.1939 bis 01.01.1940 Heimaturlaub. Weihnachten zu Hause – und das in Kriegszeiten. Dann beginnt der Westfeldzug. Karl schreibt: „Über die Luxenburger Grenze am 12.05.1940 morgens um 6 Uhr Über die Belgische Grenze am 14.05.1940.“ Mir ist beim Lesen und wiederholten Lesen der Zeilen, als könnte ich die Euphorie des jungen Soldaten spüren, als könnte diese euphorische Stimme hier zu mir, in das Jahr 2014, in all ihrer Intensität vordringen und sagen: „Endlich passiert etwas! Endlich geht es los! Auf dem Vormarsch in Frankreich!!!!!“ – fünf Ausrufezeichen. Diese fünf, mit aller Wucht tief in das Papier geschlagenen Ausrufezeichen stehen so da, obwohl mindestens zehn Jahre nach Ende des Krieges getippt. Was es für einen 1914 geborenen jungen Deutschen bedeutete, in Frankreich einzumarschieren, können wir uns heute kaum noch vorstellen. Als Kind seiner Zeit, geprägt von der überall vorherrschenden Propaganda, muss er sich als Teil einer historischen Großtat gefühlt haben. Endlich überwindet Deutschland die „Schmach von Versailles“, zahlt es dem Erbfeind heim. Er muss begriffen haben, dass er Teil eines großen historischen Ereignisses war. Der einfache Soldat, Karl Krüger aus Bierbergen, dessen Vater nichts weiter als ein Arbeiter war, machte Geschichte oder war zumindest dabei, wenn sie gemacht wurde. Ist ihm wirklich dieser Stolz als kalter prickelnder Schauer den Rücken heruntergelaufen? Auch noch als er den Kalender abtippte? Oder hatte sich seine Wahrnehmung und Bewertung dessen, woran er beteiligt gewesen war, gewandelt? Ich glaube, er war da hin- und hergerissen. Hin- und hergerissen zwischen der Euphorie seiner Jugend und der Belehrtheit des Älteren, des Nachkriegsdeutschen.
Die Stationen des Vormarsches in Frankreich sind durch je zwei Schrägstriche „//“ voneinander abgesetzt. Das wirkt fast modern, expressionistisch, auf jeden Fall setzt sich so die Geschwindigkeit der fünf Ausrufezeichen ungebremst fort: Mouson // Stenay // Verdun // Saint Mihiel // Nancy. Stakkatohaft // Trommelfeuer: Assoziationen. Hier läuft es mir kalt den Rücken herunter. Bei seinen Unterlagen findet sich auch ein etwa DIN A6 großer vergilbter Pappzettel, versehen mit der handschriftlichen Notiz: „Vormarschweg in Frankreich 71. Division“. Zu sehen ist eine Karte der Region zwischen Luxemburg, Verdun und Nancy mit der verzeichneten Marschroute, links daneben ein Text in der zeittypischen Fraktur, überschrieben mit „Soldaten!“, unterschrieben mit „Es lebe der Führer!“, vom Kommandeur der Division Karl Weißenberger. Auch hier spürt man noch einmal die Euphorie: „Ihr habt das Panzerwerk 505 erstürmt und die Höhe 311 erobert. Damit habt ihr als erste deutsche Truppe die eigentliche Maginotlinie durchbrochen.“ Die Division wurde später „Die Glückliche“ genannt, ein Kleeblatt ihr Symbol – das Glück verließ sie dann spätestens in Stalingrad. Zumindest wenn man 90 Tote, 446 Verletzte und 17 Vermisste aus den eigenen Reihen bei der Erstürmung des besagten Panzerwerkes noch unter ‚glücklich‘ verbuchen mag.
Читать дальше