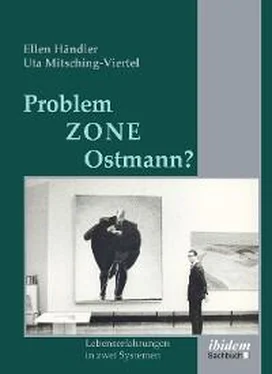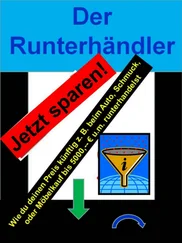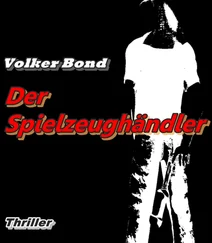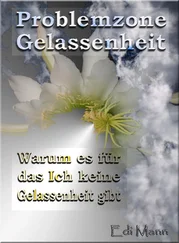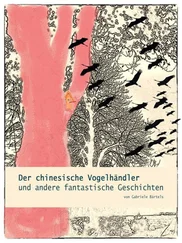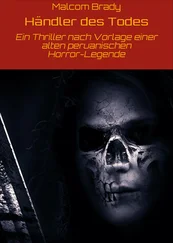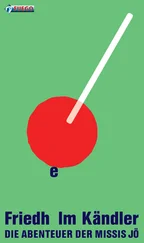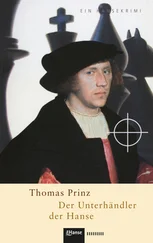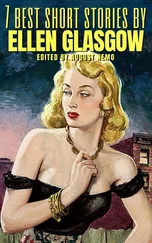Die Volkskammerzeit war vorbei und wir mussten uns überlegen, was wir mit unserem gerade angefangenen politischen Leben weiter machen. Ich bin in den Bundestag kooptiert worden, fuhr nach Bonn und wusste schnell, egal, was du politisch mal machst: Bonn wird es nicht. Ich kam aus einer Stimmung im Osten mit täglichen Demonstrationen, die Luft brannte, nach der Währungsunion brachen die Betriebe zusammen, die Leute waren auf 180 und manchmal auf 200 – und in Bonn plätscherte ruhig der Rhein vorbei, alles ging seinen normalen Gang. Mein Gefühl war, dass man hier in einer anderen Welt lebte.
Wir, eine Crew aus der Volkskammerfraktion – Günter Nooke, Marianne Birthler und ich –, überlegten uns: »Wir gehen in unser Stammland Brandenburg und treten da in den Landtagswahlkampf ein. Wir machen Wahlkampf als Bündnis 90 für unsere Vorstellungen aus der friedlichen Revolution.« Wir verabredeten uns für den Wahltag abends in einem Café. Wir wollten uns verabschieden und jeder in sein berufliches Leben zurückgehen, nur eben nicht kampflos, sondern einen Schlusspunkt setzen. Dann kam das Wahlergebnis, und siehe da: Die Grünen, sie kandidierten gegen uns, kamen nicht in den Landtag, aber das Bündnis 90. Also mussten wir uns am Abend wieder umorientieren. Wir stellten eine Fraktion mit sechs Leuten im neugewählten brandenburgischen Landtag. Wir gingen in Koalitionsverhandlungen mit der SPD unter Manfred Stolpe und der FDP. Daraus wurde die erste Ampelkoalition von 1990 bis 1994 und ich wurde Minister für Umweltschutz und Raumordnung.
Jedes Bundesland hat ein Partnerland, wir Nordrhein-Westfalen. Und NRW hatte alles für Brandenburg durchgeplant. Vor allem das Personelle. Ich hatte mich als Umweltminister in den ersten Tagen nach einem Staatssekretär umgetan, der sich in der EU und ihren Regularien auskannte. Vor Monaten hatte ich jemanden kennengelernt, der Sekretär des Umweltausschusses des Parlaments war, wir verstanden uns, und ich fragte ihn, ob er nicht für vier Jahre Lust hätte, mein Staatssekretär zu werden. Er sagte zu, war allerdings in der CDU. Der frischgebackene Chef der Staatskanzlei holte mich zum Gespräch. Er wählte dabei schon den falschen Anfang: »So, junger Mann, nun setzen Sie sich mal.« Ich sagte: »In dem Duktus wollen wir mal nicht weitermachen, wir sitzen hier auf gleicher Augenhöhe.« Wahrscheinlich war ich ihm suspekt. Er sagte: »Du kannst es ja machen, wie du dir das politisch vorstellst, aber ein CDU-Staatssekretär in der SPD-Regierung, das geht gar nicht. Und außerdem haben wir da bereits jemanden vorgesehen.« Ich habe gesagt: »Mein Lieber, das kann alles sein. Ich berufe diesen Staatssekretär, und der Ministerpräsident muss entscheiden, ob er das anders will. Dann muss er sich aber einen anderen Minister suchen.« Ich habe den Staatssekretär berufen. Heute würde ich natürlich auch sagen, dass Parteibindung eine Rolle spielt. Damals war ich eben trotzig.
Meinen Startvorteil bildeten die gute Ausbildung in der DDR und acht Jahre Arbeit im Umweltschutz. Ich war also fachlich recht gut vorbereitet. Die 1990er Jahre waren vom ersten Tag an eine unheimlich spannende, aufregende Zeit. Wenn ich früh kam, wusste ich nie, was abends war. Die Zeit hielt für unzählige Menschen große Härten bereit. Wir haben oft im Kabinett besprochen, welche Betriebsschließungen wieder zu verkünden seien und wer dorthin fahren würde. Es war frustrierend, weil man als Politiker den Menschen Hoffnung geben will. Man musste zu vielen Gelegenheiten sagen: »Es tut mir leid, ich kann euch nicht mal sagen, dass etwas Neues entsteht.« Und wir sagten auch: »Wenn ihr noch jung seid, sucht euch im Westen etwas, hier wird so schnell nichts Adäquates da sein.« In dieser Zeit verlor ich einen Teil meiner Haare. Für Fragen von Umwelt- und Naturschutz war zwar die Zeit nicht geeignet, weil die Leute andere Sorgen hatten, andererseits konnten wir sehr viel für den Landschafts- und Naturschutz in Brandenburg tun, was in einer nur mit Juristen besetzten Verwaltung vielleicht gar nicht mehr so gelungen wäre. Damals ging das noch.
Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich zwei Systeme erlebt habe, weil das Leben sich in Relationen abspielt und der Mensch Alternativen braucht und sie kennen sollte. Da ich 35 Jahre in dem einen System und bereits 30 Jahre in dem anderen gelebt habe, fällt mir der manchmal nötige Perspektivwechsel nicht so schwer.
Das Fazit für mich ist klar: Ein System, das aus Menschen quasi per Verordnung bessere Menschen machen will, kann nicht funktionieren. Einer meiner Hauptvorwürfe an die DDR ist: Freiheitsbeschneidung und Kreativitätsbegrenzung. Das macht jedes Land am Ende kaputt. Damit hat man auch den Grundgedanken einer sozialistischen Gesellschaftsordnung, Gerechtigkeit für alle, Verteilung der Güter nach Möglichkeiten und Bedürfnissen, kaputt gemacht. Ich schätze heute an unserer Gesellschaft sehr, dass sie Liberalität aufweist, dass Menschen so, wie sie sein wollen, es materiell auch sind, sein können. Ich schätze nicht, dass wir zunehmend zulassen, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr öffnet und deshalb die Freiheitsmöglichkeiten, die die Gesellschaft bietet, viele gar nicht nutzen können. Ich finde den Grundgedanken einer sozialen Markwirtschaft richtig, zu balancieren, wie man die Triebkräfte der Gesellschaft voranbringt. Die Menschen brauchen die Möglichkeit, eigene Ideen anzugehen. Auf der anderen Seite muss eine Begrenzung da sein. Helmut Schmidt hat einmal gesagt: »Ein Kapitalismus, der keine Begrenzung hat und nicht kontrolliert wird, wird automatisch zum Raubtierkapitalismus.« Gesellschaftsorganisation unter freiheitlichen Bedingungen ist eine Sisyphusarbeit. Der Stein ist unten, du musst ihn wieder hoch rollen, dann rollt er wieder runter, und du musst ihn wieder hochrollen. Bis vor kurzem hatten wir die neoliberale Phase, zum Beispiel die Privatisierung vieler öffentlichen Güter. Vieles davon bereuen wir heute wieder. Es ist bedauerlich, dass wir so eine Phase immer wieder brauchen. Ich glaube, der Kapitalismus hat sich durch den gefühlten Mitbewerber, das sozialistische Lager, besser benommen, weil er wusste, dass er sich beweisen muss. Als das weg war, konnte man noch mal dem neoliberalen Affen richtig Zucker geben. Das hat sich nicht unbedingt positiv ausgewirkt.
Dass ich 1995 Sozialdemokrat wurde, war durch Vater und Großvater mitgeprägt. Mein Vater war mit seinen DDR-Erfahrungen an sich dagegen, dass ich in eine Partei gehe. Er sagte: »Aber wenn du das schon machst, versuche wenigstens, ihr Vorsitzender zu werden.« Habe ich versucht. Es hat im Land Brandenburg für 13 Jahre geklappt. Im Bund gab es leider gesundheitliche Begrenzungen. An der Sozialdemokratie finde ich so faszinierend, dass es, wie Willy Brandt einmal sagte: »Hier ein donnerndes Sowohl-als-Auch gibt.« Nichts Extremistisches, immer neu denken an den sich wandelnden Interessen möglichst vieler Menschen entlang – schwierig, aber sinnvoll.
Was mir in unserer gesellschaftlichen Entwicklung im Moment fehlt, ist die Liebe zum Kompromiss. Wir sind sehr absolut geworden. Es gibt viele widerstrebende Interessen, und wenn Demokratie einen Sinn haben soll, hat sie ihn dann, wenn man aus den vielen Interessen versucht, am Ende einen Kompromiss zu formulieren, mit dem alle einigermaßen leben können. Der Hauptvorwurf, der immer gemacht wird, ist, dass das alles so lauwarm ist. Da entgegne ich als Naturwissenschaftler: Der Mensch lebt bei 37 Grad Körpertemperatur, bei 42 Grad ist er tot, bei 32 Grad auch.
Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass die Seele der Demokratie die Liebe zum Kompromiss ist. Bei allem, was ich jetzt mache, die Beziehungen zu unserem russischen Nachbarn im Deutsch-Russischen Forum zu pflegen, Aufgaben in der Kohlekommission oder in der Einheitskommission wahrzunehmen, versuche ich immer zu vermitteln. Das Leben spielt sich meist in der Mitte von allem ab. Wir müssen versuchen, uns diese Fähigkeit zu erhalten. Die Fähigkeit des Zuhörens- und Verstehen-Wollens nicht zu verlernen, ist nicht lapidar. Ich möchte, wenn ich in eine Diskussion gehe, danach an zwei, drei Stellen klüger geworden sein – sonst war es Verschwendung von Lebenszeit.
Читать дальше