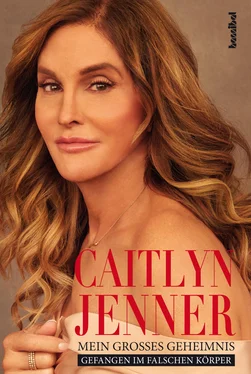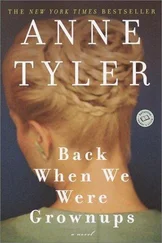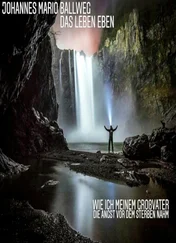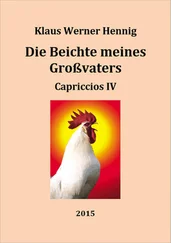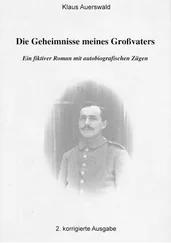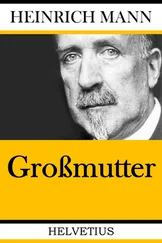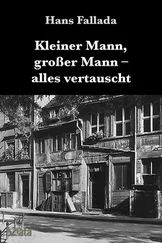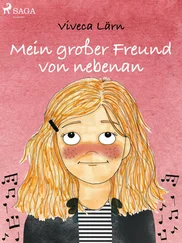Etwa vor einem Jahr kam ich mit einer Transgender-Frau aus South Dakota in Kontakt, die überzeugt war, dass sie wegen des transfeindlichen Klimas in ihrem Heimatstaat keine Arbeit findet. Erst kurz zuvor war dort heftig über eine Gesetzesvorlage gestritten worden, derzufolge Transgender-Schülern verboten werden sollte, sich nach dem gefühlten Geschlecht zu entscheiden, ob sie lieber die Jungs- oder Mädchentoiletten benutzen wollten; das Vorhaben scheiterte erst am Veto des Gouverneurs. Davon abgesehen waren in South Dakota weitere Gesetze in Vorbereitung, die sich gegen die LGBTQ-Community richteten. Sie hatte natürlich recht – die Atmosphäre war vergiftet.
„Niemand wird mich einstellen.“
Wir telefonierten mindestens ein Dutzend Mal. Als ich sie nach ihren Interessen fragte, erklärte sie, sich gut mit Make-up auszukennen und etwas in dieser Richtung machen zu wollen. Da ich gute Kontakte zu MAC Cosmetics hatte, schlug ich vor, dass sie sich nach Filialen des Unternehmens umsehen sollte, und versprach, dann bei der Geschäftsleitung anzurufen und mich für sie zu verwenden. Leider gab es keine MAC Stores in ihrer Nähe, und daher überredete ich sie, es doch einmal in einem Kaufhaus zu versuchen. Sie hatte schreckliche Angst vor dem Vorstellungsgespräch. Aber dann bekam sie den Job, und später schickte sie mir ein Video, auf dem sie vor lauter Glück in Tränen ausbrach.
Nichts davon macht mich zu etwas auch nur annähernd Besonderem. Es ist nur menschlich.
Man darf nie aufhören, sich für dieses Thema einzusetzen. In diesem Zusammenhang hat Chandi Moore einmal etwas sehr Wichtiges gesagt, das ich nie vergessen werde. Chandi ist die Transfrau, die später an I Am Cait, meiner Reality-Show im Fernsehen, entscheidend mitgewirkt hat, und sie hat viele Jahre im Children’s Hospital Los Angeles im Rahmen eines Förderprogramms zur Stärkung der Gesundheit mit Kindern gearbeitet, die trans oder gender-nonkonform sind. Gleich bei unserem ersten Treffen fiel sie mir ins Wort, wie das für Chandi so typisch ist, wenn es etwas gibt, das unbedingt gesagt werden muss.
„Man kann nicht jede Seele retten, aber man kann eine Seele nach der anderen retten.“
Ich verstand, dass man noch so oft über die großen Themen reden kann, und dass das auch wichtig ist, aber man muss auch auf persönlicher Ebene tätig werden. Das hat seine Grenzen. Natürlich kann ich nicht jeden Selbstmord verhindern, so sehr ich mir das auch wünschen würde. Aber ich weiß, wie entscheidend es sein kann, wenn man einen Menschen ganz direkt anspricht. Genau deswegen mache ich das auch immer wieder. Ich hoffe, dass andere in meiner Position sich anschließen werden. Wenn wir alle eine Seele nach der anderen retten, werden wir gemeinsam Tausende bewahren können.
Ich sehe den Ballons hinterher, die von dem schmalen Strand in den Himmel aufsteigen. In mir ist nicht nur Trauer, sondern auch Zorn. Das hier hätte nicht geschehen müssen, wenn sich unsere Gesellschaft ein wenig mehr um Akzeptanz als um Ablehnung bemühen würde, und um Inklusion statt Exklusion. Hört auf, Ausgestoßene aus uns zu machen. Wir sind eine sehr lebendige und vielfältige Community.
Unwillkürlich drängt sich mir das Bild auf, wie Kyler Prescott leblos auf dem Badezimmerfußboden liegt. Und wie seine Mutter ihn gefunden hat. Dann erinnere ich mich an das Gedicht, das er geschrieben hat. Es war nicht nur ungewöhnlich bewegend und schön für einen Vierzehnjährigen, es fing zudem genau ein, was ich stets gefühlt hatte, wenn ich in den Spiegel sah und mir jemand entgegenblickte, den ich nicht erkannte. Es beschrieb den Widerstreit in uns allen perfekt:
Mein Spiegel definiert mich nicht:
Nicht die Fremde, die mir entgegenblickt
Nicht das glatte Gesicht, das zu jemand anderem gehört
Nicht die Augen, in denen Traurigkeit schimmert
Wenn ich nach ihm suche und nur sie erkennen kann.
Mein Körper definiert mich nicht:
Nicht die schmalen Schultern, die nie anders sein werden
Nicht die Hüften, die mich verraten
Nicht die Brust, deren Anblick ich nicht ertrage
Wenn ich nach ihm suche und nur sie erkennen kann.
Meine Kleidung definiert mich nicht:
Nicht das T-Shirt und die Jeans
Die so perfekt an ihm aussehen würden
Und von denen ich weiß, dass sie mir niemals passen werden
Wenn ich nach ihm suche und nur sie erkennen kann.
Schon seit Jahren suche ich nach ihm
Aber ich scheine mich immer weiter von ihm zu entfernen
Mit jedem Tag, der verstreicht.

Sportunterricht in meiner Grundschule in Tarrytown. Unser Sportlehrer hatte auf dem Parkplatz ein paar Hütchen aufgestellt, um die Strecke für einen Wettlauf zu markieren.
Schauen wir also mal, wie wir uns dabei schlagen.
Bisher hatte ich mich noch nie für eine Sportmannschaft gemeldet, und ich hatte keine Ahnung, ob ich in Sport gut oder schlecht war. Ehrlich gesagt, war ich nicht besonders ehrgeizig. Wenn ich etwas tat, dann meistens, weil es einfach Spaß machte und mir von Natur aus lag. Und dieser Wettlauf schien so etwas zu sein.
Jeder in der Klasse rannte um die orangenen Hütchen herum, und der Lehrer stoppte die Zeit und schrieb sie für uns alle auf. Dann sah er mich an. Klassenkameraden, die mich noch nie beachtet hatten, klopften mir auf die Schulter. Und die Stoppuhr des Lehrers bestätigte es: Ich bin der Schnellste der ganzen Schule!
Vielleicht gab es also doch ein Gebiet, auf dem ich glänzen konnte. Und die sportlichen Erfolge brachten ja nicht nur Anerkennung. Was gab es Besseres, um seine Männlichkeit unter Beweis zu stellen? Oder um diese komische Sache irgendwie wegzuschieben? Sportskanonen zogen keine Frauenkleider an. Sportskanonen liefen auch nicht mit einem Kopftuch durch die Straßen. Die standen in der Umkleide und zeigten stolz, wie lang ihr Ding war. Wir waren die Größten.
Sport war in den Sechzigern (wie heute übrigens auch noch) die perfekte Tarnung. Hier regierte die Männlichkeit, besonders die weiße. Eine gesetzlich geregelte Gleichberechtigung der Geschlechter gab es nicht. Eine Integration fand im College-Sport nur langsam und gegen viele innere Widerstände statt. Für alles, was mit dem Geschlecht oder der Sexualität zu tun hatte, bot Sport wiederum den perfekten Schutz. Ein Sportler, der sich in den Sechzigern als transgender outete? Unmöglich. Das Netzwerk existierte nur im Untergrund: Wer offen lebte, riskierte, belästigt oder verhaftet zu werden. Stonewall, das große Schicksalsereignis der LGBTQ-Bewegung, fand erst 1969 statt, als ich schon aufs College ging. Damals kam es bei einer Razzia im New Yorker Stonewall Inn zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei, die weltweit Schlagzeilen machten. Besonders Transfrauen waren bei der Durchsuchung des Clubs mit den üblichen Polizeimethoden schikaniert worden: In New York war es damals gesetzlich vorgeschrieben, mindestens drei Kleidungsstücke zu tragen, die eindeutig dem biologischen Geschlecht zugeordnet werden konnten, und wenn die Polizei jemanden im Verdacht hatte, das nicht zu tun, kam er in Gewahrsam und musste sich abtasten lassen oder ausziehen.
Eines der ersten Outings im Sport gab es 1975, als ich 26 Jahre alt war. Damals bekannte der Footballer Dave Kopay in einem Interview mit dem Washington Star, homosexuell zu sein. Zuvor hatte die Zeitung in einer Serie einen anonymen schwulen Footballer zitiert, und Kopay erkannte, dass es jemand war, mit dem er einmal geschlafen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte er seine Profikarriere schon seit zwei Jahren beendet – hätte er das vorher getan, wäre seine Karriere automatisch vorbei gewesen. (Selbst heute gibt es in einer der großen Basketball-Ligen oder im American Football kaum offen schwule Sportler. Weibliche Profis gehen wesentlich offener mit ihrer sexuellen Orientierung um, was darauf hindeutet, dass die Atmosphäre dort nicht so feindselig ist, und die Athletinnen gehen viel ehrlicher und wertschätzender mit sich um.)
Читать дальше