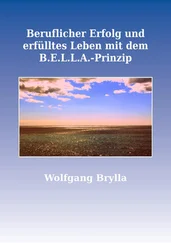„Wahnsinn“, entgegnete Mike. „Okay. Organisier das.“
Als ich mich in die Liste der auftretenden Bands versenkte, entdeckte ich Crosby, Stills & Nash, deren Debütalbum, Suite – Judy Blue Eyes, rasch die Charts emporkletterte. Etwas sagte mir, dass sich der Pfad meines Lebens und der des jungen Stephen Stills auch in Zukunft kreuzen würden.
Ich hatte recht damit, dass alle nach Bethel kommen würden – am Schluss waren es eine halbe Million Menschen. Als wir mit einer Gruppe von Freunden aus New York in einem alten Chevrolet Suburban eintrafen, schien es, als versuchte jedermann, durch dasselbe zwei Meter breite Tor zu gelangen, auf das auch wir zusteuerten. Unter den Leuten in unserem Konvoi befand sich auch Season Hubley, das hübsche Mädchen, in das ich mich verliebt hatte, als sie zwei Jahre zuvor nach Gainesville gekommen war. Leider war sie mit einem anderen dort. Ich wünschte, sie wäre mit mir zusammen statt mit ihm, was mir das gesamte Erlebnis des dreitägigen Festivals verdarb.
Ich kann mich erinnern, dass es häufig regnete. Es gab einen unglaublichen Sturm, der mit großen, geballten Wolken von Osten her heraufzog. Die kräftigen Winde bliesen beinahe die wackeligen Lautsprechertürme um. Wir schliefen in Schlafsäcken in dem Chevy und hörten zu, wie der sintflutartige Regen auf das Autodach prasselte. Als Sturm und Regen zu stark wurden, musste die gesamte Bühnenelektronik mit Plastikfolie abgedeckt werden, damit es zu keinem Kurzschluss kam. Abgesehen von dieser Unterbrechung, gab es nonstop Musik. Wir lagen hinten im Auto, waren total zugedröhnt und warteten gespannt, wer als Nächstes angekündigt werden würde.
„O Mann, das muss ich sehen“, sagte ich dann und raffte mich auf, stieg aus dem Wagen und schlitterte im Regen den rutschigen Hügel hinunter in Richtung Bühne. Dort lauschte ich den Klängen von Santana, Hendrix oder Alvin Lee, bis ich glaubte, mir müsste das Blut aus den Ohren schießen.
Es war eine Schlammschlacht, absolut grauenhaft, kalt und nass. Der klebrige Lehm drückte sich zwischen unseren Zehen empor und fand seinen Weg in jede Pore und jede Falte, aber das schien niemanden zu kümmern. Gemeinsam mit Tausenden anderer Menschen stand ich im strömenden Regen, wiegte mich im Takt zur Musik, dann kehrte ich zurück und trocknete mich ab. Die Autofenster beschlugen, bis die Matschkruste endlich getrocknet war. Woodstock war wirklich eine Erfahrung für sich.
Als wir nach dem Festival wieder zurück in Dover Plains waren, fiel es mir auf einmal nicht mehr ganz so leicht, unser Dasein zu ertragen. Ich hatte Stephen Stills als Jugendlichen gekannt, doch nun war er in Woodstock aufgetreten, um vier Uhr morgens, auf derselben Bühne wie die Großen des Rock ’n’ Roll, und hatte mit Leuten wie Graham Nash musiziert, den ich so bewundert hatte, als er mit den Hollies nach Gainesville gekommen war. Es war erst das zweite Mal, dass Crosby, Stills & Nash live zusammen spielten, aber sie waren verdammt heiß. Stephen saß auf einem Barhocker, trug einen blauweißen Poncho und sang mit seiner eindringlichen, leicht rauen Stimme. Es war mitreißend. Ich hätte alles dafür gegeben, hätte ich nur dort oben an seiner Seite sein können.
Stattdessen hing ich mit einem Haufen Kiffer in irgendeinem großen Haus in der Pampa herum und versuchte, eine Situation zu retten, von der ich genau wusste, dass sie aus dem Ruder lief. Ich fühlte mich menschlich und musikalisch völlig isoliert. Wir waren meilenweit von allem entfernt, und es gab keine Mädchen oder Freunde außerhalb der Band. Der Winter nahte, und wir waren pleite. Niemand schien zu begreifen, dass wir in diesem riesigen, unbeheizten Haus zu erfrieren drohten, wenn wir nicht schleunigst etwas unternahmen.
Der Winter kam und mit ihm der Schnee. So etwas hatte ich noch nie gesehen: In New York oder Boston waren vielleicht einmal ein paar Flocken gefallen, aber der Schneefall hier war so stark, dass er sich wie weiches, feines Puder vor unserer Vordertür anhäufte. Er roch nach Stahl. Zu Anfang war es ein Spaß, wir veranstalteten Schneeballschlachten und alberten herum. Als der Reiz des Neuen jedoch verflogen war, isolierte uns der Schnee in unserer ohnehin angespannten Situation nur noch mehr. Ohne jede Fluchtmöglichkeit waren wir nun tagein, tagaus zusammen im Haus gefangen. Die Spannungen zwischen uns traten immer deutlicher zutage. Jene bitteren letzten Monate erinnerten mich an mein letztes Jahr im Haus meiner Eltern, und es tat mir auf einmal leid, dass wir im Streit auseinandergegangen waren. Eines Tages in jenem Winter setzte ich mich an einen Schreibtisch, den ich aus alten Holzresten gezimmert hatte, die im Hof herumgelegen hatten. Ich nahm einen Stift und Papier und schrieb einen Brief an meine Mutter, in dem ich ihr mitteilte, wo ich war und dass alles in Ordnung sei. „Danke für all die Jahre, in denen Du mich unter schwierigen Lebensumständen großgezogen hast“, schrieb ich, „und für alles, was Du mich gelehrt hast. Erst jetzt beginne ich zu begreifen, was für eine gute Mutter Du mir warst.“ Ich dankte ihr sogar dafür, dass sie mich am Ohr in die Kirche gezerrt hatte. Ich versah den Umschlag mit meiner Adresse und warf ihn ein. Es war der erste Kontakt mit meinen Eltern seit zwei Jahren, und bald kam ein Antwortbrief mit der Post.
„Lieber Don“, schrieb sie. „Wie wundervoll, von Dir zu hören. Ich habe mich zu Tode geängstigt …“ So begann eine Korrespondenz mit ihr, die viele Jahre andauerte. Mein Vater schrieb nie ein Wort.
• • •
Ich begann zu begreifen, dass meine Träume, ein Musikstar zu werden, möglicherweise nichts als Luftschlösser waren. Es war das sogenannte „Ichjahrzehnt“ nach Vietnam, für mich indes liefen die Dinge nicht besonders gut. Unser einziges regelmäßiges Engagement war am Goddard College in Plainfield, Vermont, einer progressiven Einrichtung für freie Künste, die ein paar Hundert Kilometer nördlich lag. Wir erlebten dort Carlos Santana, wie er sein „Black Magic Woman“ spielte, was damals ein großer Hit war. Arlo Guthrie war Musikstudent am College, und sie hatten sogar eine Gamelangruppe, ein indonesisches Percussionorchester. Als wir eines Tages zu einem Auftritt am Goddard unterwegs waren, gab ich einem plötzlichen, dringenden Bedürfnis nach. Ich parkte den Lieferwagen neben einem Münzfernsprecher, kramte etwas Kleingeld hervor und wählte die Nummer von Susans Familie in Boston, die ich die ganze Zeit über im Kopf behalten hatte.
„Hallo, Mistress Pickersgill, hier spricht Don, Don Felder aus Gainesville. Ist Susan da?“
„Hallo, Don. Das ist ja eine ganze Weile her. Nein, mein Lieber, sie lebt nicht mehr hier. Sie hat eine eigene Wohnung gefunden. Möchtest du vielleicht ihre Nummer?“
Susan war sehr überrascht, von mir zu hören. Achtzehn Monate waren vergangen, seit wir das letzte Mal etwas voneinander gehört hatten. Sie hatte gerade mit ihrem letzten Freund Schluss gemacht, einem Sänger und Gitarristen, und arbeitete im Harvard History Research Center als Sekretärin. Wir plauderten, bis mir das Geld ausging, und ich versprach, sie wieder anzurufen. Eine Woche später tat ich es, dann wiederum eine Woche später. Es war ein gutes Gefühl, mit jemandem zu reden, der nicht die ganze Zeit total zugekifft war. Sie hatte einen guten Job und ihre eigene Wohnung – etwas, das ich mir niemals hätte leisten können. Ich war beeindruckt.
Ein paar Wochen darauf erzählte mir Susan, dass sie eine Weile im Haus ihrer Schwester in Scituate auf Cape Cod verbringen würde, um dort deren Kind zu hüten. „Willst du auch rauskommen?“, fragte sie mich. „Wir könnten uns wieder kennenlernen.“ Mein Leben war zu einem Trümmerhaufen geworden, also ergriff ich die Gelegenheit beim Schopf. Als das Wochenende an jenem wunderschönen Atlantikstrand zu Ende ging, war uns beiden klar geworden, wie sehr wir einander immer noch liebten. Es war, als wäre ich nach Hause gekommen.
Читать дальше