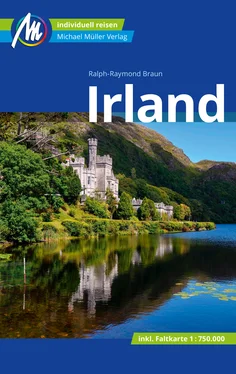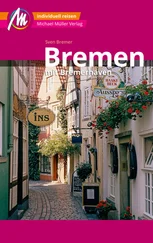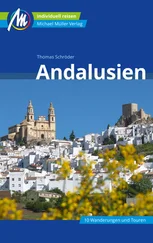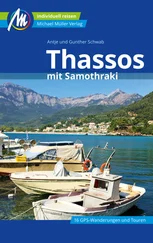Prominentengräber auf dem Glasnevin Cemetry
Croke Park
Auch Irland hat seinen heiligen Rasen, den hierzulande allerdings kaum jemand kennt. Er gehört der Gaelic Athletic Association (GAA), die mehr Gralshüter irischer Identität als ein herkömmlicher Sportverband ist. Lange waren im „Croker“, wie das mit 82.000 Plastiksitzen größte Stadion der Insel genannt wird, nur die traditionell irischen Leibesübungen , gälischer Fußball und Hurling erlaubt, nicht aber Rugby und Soccer, das Fußballspiel nach FIFA-Regeln. Als Attraktion werden Skyline-Touren über die aussichtsreiche Dachlandschaft des Stadions angeboten.
Ob die DFB-Kicker, als sie sich hier für die EM 2008 qualifizieren mussten, zuvor auch das im Bauch der Cusack-Tribüne eingerichtete Sportmuseum der GAA angeschaut haben, wissen wir nicht. Für irische Schulklassen und irisch-stämmige Amerikaner ist der Besuch jedenfalls Pflicht. Hier erfahren sie allerlei zu der eng mit der Nationalbewegung verbundenen Geschichte der gälischen Spiele (übrigens kein rein irisches Phänomen, wie ein Display mit Turnvater Jahn demonstriert), lernen die Regeln kennen und können Banner und Trophäen bestaunen. Per Touchscreen kann man sein frisch erworbenes Wissen testen und Aufzeichnungen berühmter Spiele und Spieler abrufen. An einer Torwand ist fußballerisches Können gefragt, andere Maschinen testen die Reaktionszeit.
♦ Museum: Tägl. 10-17 Uhr, Juni-Aug. bis 18 Uhr; Einlass bis 30 Min. vor Schließung. Eintritt 7 €, mit Stadionführung 14 €. Die Zeiten der täglichen Führungen findet man unter www.crokepark.ie. Skywalk: Tägl. (Okt.-April nur Fr-So) 10-15 Uhr, Juli/Aug. bis 16 Uhr. Eintritt mit Museum und Stadionführung 21 €. Der Eingang zum Stadion ist von Nordwesten via Clonliffe Rd. Bus 3, 11, 16, 44, 123 ab O’Connell St, DART Station Drumcondra.
Docklands
Nirgendwo sonst hat die Stadt ihr Gesicht so schnell und drastisch verändert wie an der Liffey östlich der Stadtmitte. Noch vor zwei Generationen waren die Docklands ein klassisches Hafenviertel mit Kais und Kränen, mit Lagerschuppen, Kopfsteinpflaster, Eisenbahngleisen und einem Heer von Schauerleuten, die in ärmlichen Vierteln hinter dem Hafen wohnten. Heute glänzt das Gebiet mit neuer Urbanität aus Glas und Stahl. Hier gibt sich Dublin als Weltstadt, mit Büros für Anwälte und Finanzdienstleister, mit Kulturpalästen und Kongresszentren, dazu Apartments für die Besserverdienenden, die es sich hier zu wohnen leisten können und ihre Blocks mit Zäunen und Kameras sichern.
Mit dem neuen Glanz kontrastieren die verbliebenen Inseln des Verfalls. Bestandsentwicklung gibt es hier nicht. Altes vermodert, bis es abgerissen wird, Neues kommt direkt vom Reißbrett. Oft genug führt die Spurensuche nach jenen dubiosen Töchtern, die mit riskanten Finanzprodukten nur scheinbar grundsolide Banken an den Rand des Abgrunds brachten, in die Docklands. Angelockt von niedrigen Steuersätzen und einer laxen Aufsicht vernichtete diese Finanzindustrie schließlich in der letzten Krise Milliardenwerte. Umso mehr erstaunt es, dass diese Zweckgesellschaften noch immer aktiv sind und die guten Adressen in Dublins neuem Bankenviertel keinen Leerstand vermelden.
Vor allem das Südufer bietet sich für eine Erkundungstour mit dem Fahrrad an. Vom Grand Canal Dock mit seinem schicken Theaterbau fährt man über Ringsend, dem Landungsplatz Cromwells, auf den South Wall, einer im 18. Jh. angelegten Kaimauer. Pigeon House Fort, das früher die Hafeneinfahrt bewachte, ist heute ein Kraftwerk. Von hier ragt der Wellenbrecher noch 2 km in die Dublin Bay, bis das Poolbeg Lighthouse Landende und zugleich die Hafeneinfahrt signalisiert.

Dublin wächst und wächst
Epic Ireland
Einer von sechs in Irland Geborenen lebt im Ausland. Und einer dieser Auslands-Iren, der frühere Coca-Cola-Chef Neville Isdell, hat der Diaspora nun für einen zweistelligen Millionenbetrag ein Museum eingerichtet. Doch was heißt hier Museum? Die Exponate stecken nicht in Vitrinen, sondern in der Cloud und erscheinen nur als Projektion, und außer Touchscreens und Spielkonsolen (das freundliche Personal hilft!) kann man nur ein paar Kunstinstallationen anfassen. Schauspieler erzählen die Schicksale der Migranten, wobei weniger die Ursachen und der Ablauf der Auswanderung als vielmehr die Erfolge der Iren in Übersee im Fokus stehen, sei’s als Politiker, Tüftler, Sportler oder Künstler. Hat der Besucher seinen eingangs ausgestellten Reisepass an allen Stationen abgestempelt, wird seine Ausdauer zum Schluss mit der Chance belohnt, eine virtuelle Postkarte an Daheimgebliebene zu mailen.
♦ Tägl. 10-18.45 Uhr, Einlass bis 17 Uhr. Eintritt 17 €. Bus Nr. 151 ab Eden Quay, Luas Station George’s Dock. Custom House Quay, epicchq.com.
Jeanie Johnston
Am Nordufer der Liffey ankert die originalgetreue und hochseetaugliche Replik eines 1847 in Quebec vom Stapel gelaufenen Schiffs, das auf 16 Fahrten nordamerikanisches Holz nach Irland und im Gegenzug irische Auswanderer nach Amerika brachte. Die neue Jeanie Johnston wurde in den 1990ern zum Gedenken an die Große Hungersnot ge- baut; gelegentlich operiert sie als Segelschulschiff und Ausflugsboot, liegt aber die meiste Zeit am Kai und kann besichtigt werden. Eine kleine Ausstellung an Bord vergegenwärtigt die Überfahrt der dicht an dicht gedrängten Auswanderer.
♦ Führungen tägl. 11, 12, 14, 15 Uhr, April-Okt. auch 16 Uhr. Eintritt 11 €. Bus Nr. 151 ab Eden Quay, Luas Station Mayor Square. www.jeaniejohnston.ie.
Abschied von Irland
Der Aufenthalt in Sandycove endete für Joyce dramatisch: Ein anderer, von Alpträumen geplagter Gast ergriff eines Nachts seinen Revolver und ballerte in das Kaminfeuer. Der Hausherr entwand ihm die Waffe und feuerte seinerseits mit den Worten „Lass ihn mir!“ auf die Töpfe und Pfannen am Bord über dem Bett, in dem Joyce lag. Der nahm den Hinweis ernst, zumal er Gogarty zuvor in einem Gedicht angegriffen hatte, und verließ am nächsten Morgen für immer das Haus, um sich mit Nora Barnacle zum Kontinent einzuschiffen.
James Joyce Tower
Schon vom Fähranleger in Dun Laoghaire erblickt man den Martello-Turm, wo „Ulysses“ beginnt und ein Museum heute die Erinnerung an James Joyce pflegt. Robert Nicholson, langjähriger Kurator und Joyce-Enthusiast, sammelte Briefe, Fotos, Manuskripte, Erstausgaben, Übersetzungen und persönliche Gegenstände des Meisters. Der junge Joyce verbrachte 1904 seine letzten Tage auf Irland in dem Turm. Sein Freund Oliver St John Gogarty, der uns im „Ulysses“ als Buck Mulligan begegnet, hatte das Gemäuer damals für acht Pfund im Jahr vom Militär gemietet. Forty Foot Pool, ein Badeplatz auf der Seeseite des Turms, war lange ein Refugium männlicher Nudisten, die selbst im Winter von den Felsen ins eiskalte Wasser sprangen. Seit sich auch Frauen den Zugang erkämpft haben, gebietet ein Schild „Badekleidung“. Der Betrieb beginnt bereits morgens um sechs, wenn Werktätige und Frühaufsteher, im Winter mit der Taschenlampe bewaffnet, sich im Meer erfrischen und stählen.
Читать дальше